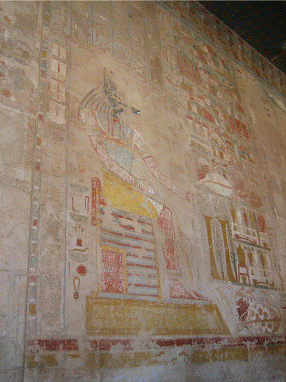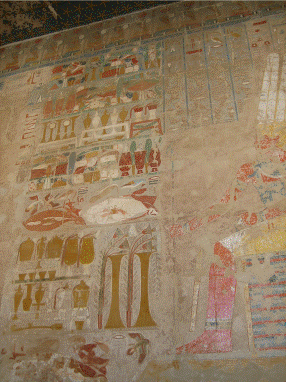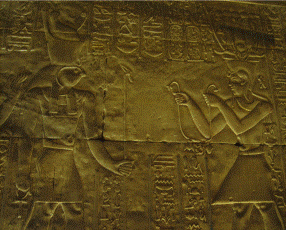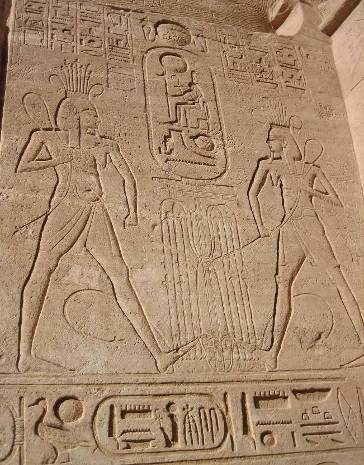Oberägypten
24. Mai bis
2. Juni 2008

Text: Irene Kohlberger
Fotos: Irene Kohlberger und
Panorama EGYPT
Landeanflug
Richtung Hurgada. Es ist drei Uhr Morgens und durch
das Fenster lassen sich Reihen von Lichtern ausmachen, die wie gerissene
Perlenketten in der Dunkelheit beginnen und ebenso unmittelbar enden. Es fehlt
das Netz von Lichtern, wie das üblicherweise bei Ortschaften der Fall ist, d.h.
es gibt hier nur reine Feriensiedlungen, die an der Küste verstreut, manchmal
mit Straßen verbunden sind und manchmal auch nicht.
Wie so oft
frage ich mich, wo der Flughafen liegen könnte, ob wir vom Meer her landen oder
vom Landesinneren aus. Meistens gelingt es nicht die Frage zu beantworten, weil
im Moment der Landung alle Übersicht vorbei ist, die Nervosität der Passagiere
und der Trubel des Aussteigens alles Nachdenken und Überlegen zu einem
vorläufigen Ende bringt.
Draußen
ist es sehr warm, wie erwartet. Die Luft fühlt sich weich an, wattig, wie aus einer überdimensionalen Klimaanlage
kommend. Wir stolpern die Gangway hinunter und gehen zum wartenden Bus, der
sich nach und nach mit den Fluggästen füllt. Es wird immer enger und wärmer. Es
ist ein Moment der unangenehmen Spannung, dieses Warten auf die Abfahrt des
Busses. Immer wieder erlebte ich dieses Gefühl des Eingesperrtsein
in die künstliche Welt des Flughafens, das sich erst löst, wenn wir den ersten
Schritt hinaus tun vor das Flughafengebäude, wo die unbekannte Landessprache
deutlich an unser Ohr dringt.
Erst dann
sind wir wirklich angekommen.
Im
Flughafengebäude sind allerdings noch einige Hürden zu überwinden. Wir brauchen
einen Visastempel, den wir bei den gut gekennzeichneten Schaltern erhalten.
Dann geht es zur die Passkontrolle. Auf dem Weg zum Gepäcks-übernahme will wieder jemand unseren Pass sehen. Doch
schließlich können wir unsere Koffer vom Laufband herunterholen und uns in die
Vorhalle des Flughafens hinausbewegen. Dort wird uns mitgeteilt, dass wir zum
Autobusbahnhof müssen und zwar zum Bus Nr. 49. Ich memoriere die Nummer und
stolpere mit meinem Rollkoffer über Gehsteigkanten und grob geschotterte
Zufahrtswege. Offensichtlich habe ich den Direktweg gewählt, der mich
schließlich ziemlich schnell, wenn auch auf anstrengende Weise, zum vorläufigen
Reiseziel bringt.
Und hier
fällt mir zum ersten Mal auf, was sich während auf der ganzen Reise immer
wieder bestätigen wird, die unglaublich exakte und vorausschauende Weise der
ägyptischen Reiseorganisation. Sie schreiben die Busse so deutlich an, dass sie
auch ein Blinder noch finden könnte und im Bus bekommen wir schon die ersten
schriftlich Unterlagen und Hinweise, was uns im Hotel erwartet. Wir werden von
einer Hand in die andere weitergereicht und wenn man sich nur ein bisschen
konzentriert, ist alles ganz klar und einleuchtend.
Offensichtlich
wird hierin langjährige Erfahrung dienstbar gemacht und wie wir später erfahren
werden, die Intelligenz des Landes in breitem Umfang eingesetzt.
Aber davon
später.
Nur kurze
Zeit sitzen wir in dem abgedunkelten Bus, der uns zum nahen Hotel bringen wird.
Unerwartet
und überraschend erwartet uns kein hochragender Hotelkomplex sondern eine große Hotelanlage von architektonischer
Schönheit. Adaptierter maurischer Stil formt die Grundanlage des Hotels Grand Resort mit großzügig gestalteten
Zimmern und Balkonen unter maurischen Bögen.



Selbst die
Swimmingpools folgen den geschwungenen Linien der Innenfronten der Hotelflügel.
Man wird nicht müde die einfallsreichen Fassaden mit vorgelagerten
Terrassentürmen zu betrachten und sich vorzustellen, wie vornehm gekleidete
Mädchen ihren Geliebten Hibiskustee servieren.
Doch es
gibt hier keine ägyptischen Mädchen – nur junge Männer, die in vollendeter
Haltung ihre Arbeit verrichten. Egal, ob sie in blauen Monturen gekleidet im
Garten arbeiten oder die Hotelgänge mit frischer Farbe nachbessern.
Die Könige
in diesem unsichtbaren Hofstaat sind die hochgewachsenen jungen Männer an der
Rezeption. In regelmäßigen Abständen schwappen hier Wellen von Touristen in die
Halle, die müde und gleichzeitig aufgeregt ihre Zimmerkarten einfordern. Doch
schon allein ihre Handbewegungen verraten Courtorsie der alten Schule – elegant
und ohne Hast bedienen sie Computer und Listen und spüren mit einem
untrüglichen Instinkt, welche Art von Persönlichkeit ihnen die Papiere reicht.
Die fast
unwillkürlich entstehende Hochachtung, die mir Männer des Mittelmeerraumes
immer wieder entgegenbrachten, weht mich auch hier wieder an und alle gut gemeinten Ratschläge in
Richtung Bakschischmentalität der Ägypter, erweisen
sich in diesem Ambiente als völlig gegenstandslos. Sicher verdienen diese
Männer ausreichend und ihr Status in der Gesellschaft ist dadurch geprägt. Doch
verfügen sie über eine Fähigkeit, die weit über professionelles Können
hinausgeht. Eine Fähigkeit, die nicht erlernt werden kann, sondern Teil ihrer
Persönlichkeit ist.
Eng und ungenehm wird es manchmal mit subalternem Personal, und
zwar wie immer und überall. Hier wirkt die eigene Not und der Neid wie eine
Blockade, die ihrer menschlichen Kompetenz entgegensteht und diese nicht selten
abwürgt.
Nach den Anmeldeformalitäten
irren wir durch die unübersichtliche Anlage. Doch es stört nicht sehr, da die
Beleuchtung und das wunderbare Ambiente im Bereich des großen Swimmingpools uns
dafür entschädigt. Schließlich finden wir unser Zimmer, obwohl die Nummerierung
so gewählt scheint, dass man den Wollfaden von Ariadne braucht, um wieder
zurückzufinden. Das System der Nummerierung habe ich auch später nicht
durchschaut – muss aber ehrlicherweise zugeben - dass es mir ziemlich egal
geworden ist.
Da ich
eine notorische Versuchs-Irrtums Lernerin bin, denke
ich nicht einmal im Traum daran den Hotelplan zu Rate zu ziehen, um die
Frühstücksräume zu finden, sondern mache mich auf den Weg. Wir halten uns links
und wieder links und so weiter und schließlich landen wir durch reinen Zufall
in einem Frühstückspavillon, wo uns einer der Servicekräfte mit der Menüfolge
des Abendessens konfrontiert – ein Faktum – das sich nach drei Stunden Schlaf,
woraus uns das heftige Klopfen des eifrigen „Reinigungspersonals“ gerissen hat
- nicht unbedingt mit Frühstück in Zusammenhang bringen lässt.
Doch
schließlich sitzen wir in dem fast leeren Pavillon, bedient von drei
Servicekräften, die zusätzlich von einem Chef beaufsichtigt werden.
Am Buffet
gibt es alles, was ein Frühstück zum Frühstück macht: angefangen bei
Müslisorten aller Art, Obst (zarte hell grüne Melonen, in feine Scheiben
geschnitten), über Eier und Käse, bis hin zu Wurst und Schinken, die sich
allerdings etwas gekränkt und eingerollt präsentieren. Als Konzession an die
deutsche Touristenbesetzung des Hotels gibt es dunkle Brotbrötchen,
Kaffee mas o menos rica ( spn: mehr oder minder gut), aber ein bisschen besser
als auf den Fährbooten Griechenlands.
Meine
Freundin Ita schwelgt in pastillas gefüllt mit Früchten, und genießt die besondere
Aufmerksamkeit von zwei der drei „dienstbereiten“ jungen Seviceherren.
Später
tasten wir uns zurück zu unserem Stockwerk. Dort angekommen, orientieren wir
uns an besonderen Zeichen, wie z. B. an einem Trockenblumenstrauß oder an einem
Tisch mit verschiedenen Ausgaben der Regenbogenpresse – ja auch das gibt es
hier – und finden schließlich unser Zimmer. Ich bleibe dort und versuche mich
zu erholen. Ita genießt den Swimmingpool. Zu Mittag essen wir in einem
hoteleigenen Restaurant – zu viel und zu üppig. Noch sind wir nicht in die
Geheimnisse der leichten Ernährung eingedrungen…
Danach
machen wir uns auf in Richtung Strand. Wieder sind einige Hindernisse zu
überwinden, auf unserem Weg zum Meer. Zunächst die Straße queren, die Halle des
Grand Hotels durch schreiten, lange Parkwege zurücklegen, bis wir endlich unten
sind auf dem aufgeschütteten Sandstrand, bedeckt mit Liegen und Sonnenschirmen.
Es ist
Spätnachmittag und es gibt kaum mehr Gäste hier---
Es ist
ruhig und wunderschön—

Am Roten
Meer

Wir
schwimmen und freuen uns am Meer, das vertraut und kühl unserer Körper umfängt.
Spät
kehren wir zurück ins Hotel – dort heißt es umziehen und zum Abendessen gehen.
Das Restaurant, das uns empfängt - d.h. eher „nicht haben“ will, heißt Marrakech – nur mit Mühe bekommen wir
einen Platz draußen zwischen Pool und den Gasträumen. Eigentlich sollten wir in
den eisgekühlten Innenräumen Platz nehmen, was aber keiner mag…
Das Buffet
reichhaltigst und sehr gut. Man könnte hier essen und
essen. Alles schmeckt vorzüglich – dafür
kommen die Getränke zu spät. Aber man kann ja nicht alles haben…
Elendigliche
Nacht - Gelsen im Zimmer – bin müde zum Sterben.
Wecken um
3 Uhr 30 in der Früh. Unser Bus startet dann gegen 5 Uhr morgens. Erst viel
später erfahren wir, warum wir so früh aufbrechen mussten.
Unsere
Fahrt nach Luxor wird von der Polizei eskortiert, d.h. wir fahren im Konvoi -
damit es sich auszahlt, wenn einer verrückt spielt. So denke ich noch, während
ich mich im Bereich eines Mekkapilger - Rastplatzes
herumtreibe.
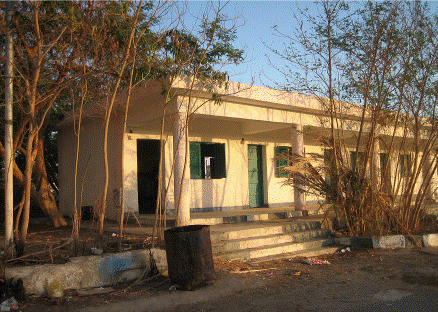

Es ist ein merkwürdiger Platz: lange
Betonbaracken erwarten hier den jährlichen Ansturm der Mekkapilger.
Um mich herum hüpfen kleine dünne Sperlinge – daneben ragen verfallene
Betonschuppen auf, wo sich innen und außen der Müll sammelt. Vor mir ein
Polizeiwagen mit Armierten. Ein junger Mann dreht auf einem Fahrrad seine
sportlichen Morgenrunden. Fliegen belästigen mich – bin müde von der letzten
kurzen Nacht. Dann verlaufe ich mich zwischen den vielen parkenden Autobussen
bis ich endlich „meinen“ Bus finde.
Seltsam ist es schon so im Konvoi
dahinzufahren – doch nicht nur diese Fahrt ist eine Folge des fortschreitenden
Wahnsinns einer nur wirtschaftlich bestimmten Welt. Wegen der Gefährlichkeit
der Strecke, 200km Wüstenstraße, fährt man zusammen, obwohl es für die
Buslenker zweifellos extrem anstrengend ist, auf diese Weise unterwegs zu sein.
Am Rückweg erleben wir auch einen Unfall, weil der Lenker eines Kleinbusses
sichtlich kurz eingeschlafen ist und den Bus über den Straßenrand gekippt
hatte. Doch ist niemand verletzt worden.
Impressionen von unterwegs
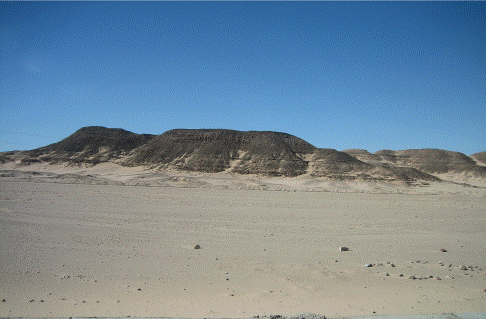


Militärbasis unterwegs
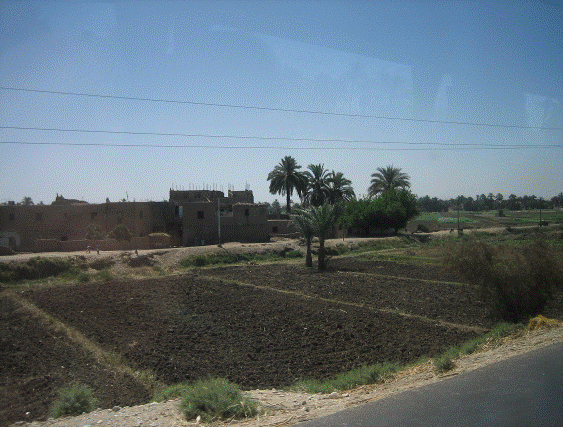
Bewässerte Felder
Eine in
sich geschlossene Welt, so ein Nilkreuzfahrtsschiff.
Beim
Hineinkommen wirkt alles, wie auf einer großen Fähre – nur alles wesentlich
eleganter – no na net!

Ein
riesiger Kristallluster beherrscht die Halle, die nach oben hin offen,
Großzügigkeit und Stil verrät. Alles glänzt und spiegelt vor Sauberkeit und es
riecht nach Räucherstäbchen. Das war anders auf den Fährbooten. Dort war
es nicht
unbedingt sauber und zudem roch es überall nach Diesel, nach verschüttetem Cola
oder Kaffee. Nicht, dass ich mich danach sehne, aber die Überfahrten nach
Griechenland mit den Schiffen haben sich tief in mein Gedächtnis eingegraben.
Jetzt
liege ich faul und quer über zwei Liegen am Deck des Luxusbootes und spüre nur
einen vollen Magen, das leise Grummeln des Motors und höre leise Musik. Ich
genieße die Freundlichkeit des Personals und schlürfe an einer
Zitronenlimonade.

Um das
Schiff dümpelt das dunkle Wasser des Nils. Obwohl wir auf einem Fluss ankern,
wirkt die Wasserfläche sehr ruhig, wie bei einem See, nur hin und wieder fegt
ein Windstoß über die ruhige Oberfläche und bedeckt sie mit silbrigen
Gitternetzen. Drüben am gegenüberliegenden Ufer bändert der Ufersaum
mit Palmen und Tamarisken - dazwischen die hellen würfelförmigen Behausungen
von Oberägypten, teils freistehend, teils halb verborgen im grünen
Uferdickicht.

Die
traditionelle Bauweise und die Armut ihrer Bewohner schaffen es bis heute die
althergebrachte Ordnung zu bewahren, was für sie selber und das Land vermutlich ein Segen ist. Sie erreichen auf
die Art ihres einfachen Lebens dasselbe, was z. B. die aufwendigen Klimaanlagen
in den Häusern anstreben, die das kalte Europa hierher exportiert hat.
Allerdings
wirken die Dörfer, die wir auf unserer Konvoifahrt
berührten, manchmal sehr desolat, vor allem die aufgelassenen Höfe, um die sich
niemand kümmert und die langsam zusammenfallen. Besonders dann, wenn die
Lehmziegel anderwärtig verwendet, die verbleibenden Gebäudereste zur
Müllentsorgung benützt werden. Diesen Anblick erträgt das mitteleuropäische
Auge nur schwer, ohne sofort auf Abhilfe zu sinnen.
Abhilfe
wozu? Wofür?
Wodurch
wäre der Anblick der offenen Schilfbündel, die auf den Flachdächern
zusätzlichen Schatten spenden, malerischer zu ersetzen? Manchmal wirken sie wie
Frisuren, die ein ungeschickter Friseur in Eile zurechtgestutzt hat…
Die
Menschen auf den Strassen folgen dem verrückten
Konvoi mit großer Ruhe in den Augen. Kinder genießen das sich immer
wiederholende Schauspiel und winken fröhlich. Männer, die ihrer mühsamen
Feldarbeit nachgehen, schauen nicht einmal auf, wenn menschlichen Wesen auf
diese seltsame Weise vorbeigekarrt werden.


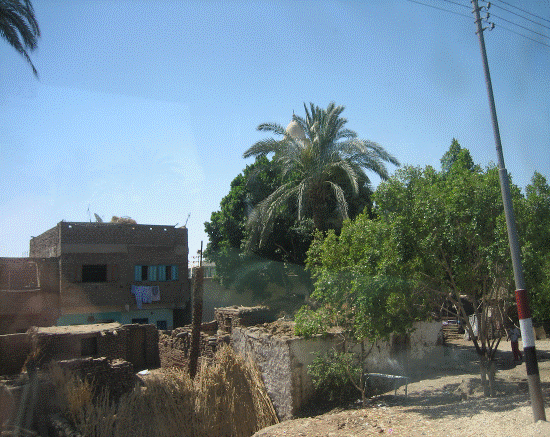
Nachdenken
verbiete ich mir – man müsste sonst die eigenen schönen Pläne sofort begraben
und Luxor und Abu Simbel vergessen und auch den
langgehegten Wunsch, auch einmal den Nil hinaufzufahren, ihn spüren, ihn sehen,
den Heiligen Fluss, der so oft in meinen Gedanken, in meiner Unterrichtsarbeit
eine wichtige Rolle gespielt hat.
Der
heilige Nil, der Lebensspender! Unzählige lobende Verse wurden ihm gewidmet. Er
war es und ist es noch heute für ungefähr achtzig Prozent der Bevölkerung und
ich bin glücklich, dass ich hier sein darf.
Es wird
Abend – ich sitze am Oberdeck und genieße den leisen Windhauch, der nach Thomas Mann immer von Norden kommt.
Warum das so ist, weiß ich nicht. Doch findet sich im Goggle
- Lexikon dafür sicher eine befriedigende Antwort.
Ich
beobachte die Sonne, wie sie langsam hinter den Ufersaum
versinkt. Ich mache Fotos und warte, bis die Sonnenscheibe schließlich hinter
dem Horizont verschwunden ist. Auch wenn die Sonne zu Mittag und Nachmittags
herunterbrennt- sie bleibt trotzdem freundlich – entsprechend dem Sonnenbild
zur Zeit Echnatons
– wo ihre Strahlen in geöffneten
Händen münden, die Mensch und Tier mit dem Lebenszeichen berühren.
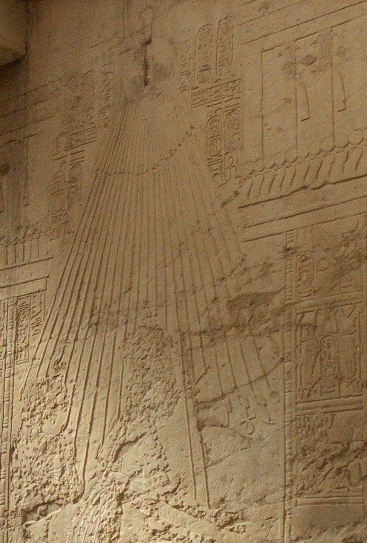

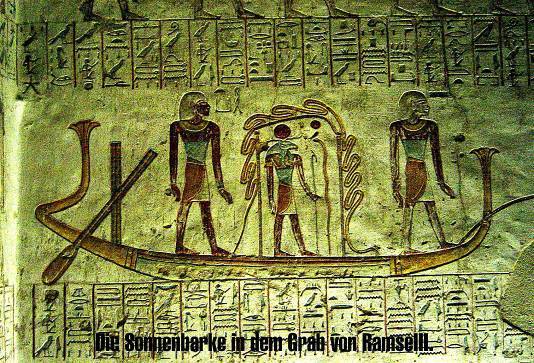
An der Stelle, wo Himmel, Erde und Unterwelt zusammenstoßen,
befand sich in der Vorstellung der alten
Ägypter ein großes Horizont-Tor, durch das die Sonne allmorgendlich die Welt
betrat. Tor des Urgewässers nannten sie es, denn beim Untergehen tauchte die
Sonne in den Urozean ein, aus dem heraus einst die
Welt entstanden war. Jeden Morgen wurde aus den mythischen Fluten die Sonne
wieder neu herausgehoben und begann ihren Lauf über dem Horizont
Der dritte
Tag führt uns ins Tal der Könige.
Wir fahren
mit dem Bus und halten zuallererst bei den Mnemnonskolossen
Die Mnemnonskolosse
gehören zu den Resten vom Totentempel Amenophis III
Die beiden Riesenstatuen galten den Ptolemäern als Abbilder
des legendenumwobenen äthiopischen Königs Mnemnon,
des Sohnes von Eos und Thitonos, der in der Schlacht
von Troja durch das Schwert des Achill den Tod fand.
Zur Namensgebung kam es wahrscheinlich durch die klangliche Ähnlichkeit
zwischen Amenophis und Mnemnon.
Die Giganten ragen 18 m auf; Reisende der Antike
betrachteten sie als Weltwunder.
Keiner der römischen Kaiser versäumte es, sie zu
besichtigen. Die magische Anziehungskraft der Riesen beruhte damals auf einem
damals nicht zu deutendem Phänomen. Wenige Jahre vor der Zeitenwende sorgte ein
Erdbeben für Schäden an einem der Kolosse.
Allmorgendlich, wenn die Sonne aufging, hörten die Besucher
einen klagenden Ton. Mnemon – so die Erklärung –
grüßte seine Mutter Eos, die Göttin der Morgenröte, die ihre Tränen in Form des
Morgentaus über den geliebten Sohn ergoss.

Und mit
dieser Erklärung sind wir wieder mittendrin im Phänomen der
Wirklichkeitsdeutung, die uns heute vom Standpunkt einer realitätsbesessenen
Zeit kaum eines ernsten Gedankens wert ist. Und dennoch, verströmt diese
Erklärung nicht mehr Zauber und Wärme, als die Erklärung, dass
Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, sowie Schwankungen der
Luftfeuchtigkeit in den winzigen Hohlräumen des Steins allmorgendlich
Felspartikel abgesprengt wurden, die für den Ton verantwortlich waren?
199 n.Chr.ließ Septimus Severus
die beiden Giganten restaurieren – seitdem bleibt ihr Gesang aus.
Gewiss hat
der moderne Erklärungsversuch damit seine Bestätigung gefunden – aber schöner
wäre es, wenn die Göttin der Morgenröte sich von der modernen Welt, die
zweifellos auch schon im römischen Empire ihre Wurzel eingesenkt hatte,
gekränkt und verletzt zurückgezogen hätte…
Diese fast
gesichtslosen mächtigen Gestalten vor einem Ruinenfeld, das nur mehr Grundrisse
erkennen lässt, berühren mich sehr vertraut. Sind doch von den antiken Bauten
selten mehr als die Grundmauern übrig geblieben, die wir Nachgeborenen nur
anhand von Plänen und mit der Kraft der Phantasie vor unserem inneren Auge
wieder aufrichten können.
Weiter
geht es in Richtung Tal der Könige. Die Bergrücken enden in gezackten Linien.
Zylindrische vom Wind geschliffene Formationen ragen auf, dazwischen spitz
zulaufenden Felder von Sand. An ihren
Flanken zeigen sich in unregelmäßigen Abständen
Sandsteinabbrüche, die von wulstförmigen festerem Material durchzogen
sind.
Alles
schon einmal gesehen, irgendwo, irgendwann und doch auch wieder nicht. Die
Kargheit der Landschaft, die jeder schützende Vegetation entbehrt, scheint mir
in eine Atmosphäre von Melancholie getaucht, die auch von den bunten
„Touristenherden“ nicht aufgehoben werden kann.



Tal der
Könige
heißt der verborgene glutheißer Kessel, wo die Herrscher des
Neuen Reiches zur letzten Ruhe gebettet wurden. Bisher wurden hier 65
Ruhestätten freigelegt. Eine archäologische Sensation ereignete sich erst 1995,
als die größte je in Ägypten gefundene
Grabanlage entdeckt wurde. Prinzipiell war diese Gruft schon seit 1820 bekannt;
der englische Armateur Archäologe James Burton hatte
einen kleinen Teil davon entdeckt, aber nicht weiter beachtet.
Ken Weeks, ein amerikanischer
Archäologe, vertiefte sich in die Reisebeschreibungen von James Burton und
entdeckte in der seit 1820 bekannten von 16 Säulen bestandenen Halle eine
verborgene Tür und dahinter eine riesige Grabanlage. Auf einem T-förmigen
Grundriss reihen sich 48 Grabkammern aneinander. Man vermutet, dass dieses
„Massengrab“ für die Prinzen von Ramses II. angelegt
worden ist. Ägypten bekanntester Pharao
hatte über 100 Nachkommen und regierte 67 Jahre. Er überlebte 13 seiner
Söhne und bei der Thronbesteigung seines Nachfolgers Merenptah
war er schon 60 Jahre alt. Kein Wunder, dass er seinen Untertanen unsterblich
vorkam.
In der Zeit zwischen der Herrschaft von Thutmosis
I. und Amenophis II.
bekam die Achse eines jeden Grabes eine 90 Grad- Abwinkelung,
alle späteren Felsenkorridore führen gradlinig in den Berg hinein.
Wir haben
Glück und betreten das Grab von Siptah ganz
alleine, nachdem der Grabwächter unsere Eintrittskarte mit einem Locher
entwertet hat (drei Gräber dürfen wir besichtigen – eine weise Einrichtung).
Siptah
war der Sohn von Seti II. Er war ein Teenager auf dem
Thron und wurde von seiner Stiefmutter Tausert und
dem vormals königlichen Schreiber unterstützt. Er regierte nur sechs Jahre.
Nach seinem Tod regierte seine Stiefmutter auch formell über das Großreich Ägypten,
wie 100 Jahre zuvor, Hatschepsut.
Schon auf
den ersten Metern des Ganges in Richtung Grabkammer überwältigt uns die
Schönheit und Lebendigkeit der dargestellten Figuren. Auch die kräftigen Farben
überraschen, wenn man bedenkt, dass die Malereien vor mehr als 2000 Jahren
aufgetragen wurden.
Ich suche
in meinem Gedächtnis nach Merkmalen, die mir die Identifikation der
dargestellten Personen erleichtern können. Manchmal bin ich ganz sicher –
manchmal glaube nur es nur zu wissen.
Aber das macht nichts. Ich werde im Laufe der Reise tatsächlich noch Months von Chons sicher unterscheiden lernen, obwohl
beide falkenköpfig dargestellt, der eine am Kopf die Mond-und der andere die
Sonnenscheibe trägt und nur die Federkrone von Month zu einem klaren Unterscheidungsmerkmal
wird.
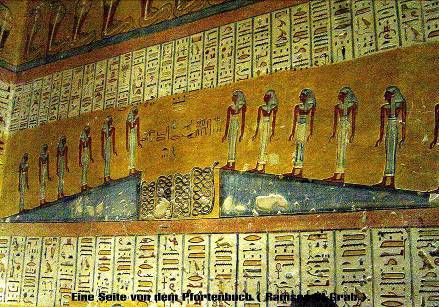
Die Dekoration an den Wänden folgte dem Buch Amduat, der „Schrift des verborgenen Raumes“, sowie dem
Pfortenbuch. Die Unterwelt des Jenseits war von Toren durchzogen, die der
Verstorbene überwinden musste, um das Reich seines Vaters, des Totengottes
Osiris, zu erreichen. Jede einzelne Pforte stellte ein Wagnis dar, um
Unberufene abzuschrecken. Zusätzlich wurden sie von schrecklichen Wärtern
bewacht. Namen, wie der
Brüllende, der Nilpferdgesichtige
mit rasender Wut, Der das Verfaulte
aus dem Hintern frisst, machen deutlich,
um welche Persönlichkeiten es sich dabei handelte. Über die bewachenden
Schlangen heißt es: Mit heißen Flammen, die nicht löscht, was sie verbrennt,
mit wirksamer Glut, geschwind im Töten, ohne zu fragen, an der niemand vorbei
zu gehen wünscht, aus Furcht vor ihrer Pein. Weitere Torhüter hießen, Mit
scharfer Glut, Die Unnahbare; Blutschlürfer, Der mit seinen Augen Feuer sprüht – und so sieht man sie auch, die Durchlässe
bewachend, an den Wänden dargestellt.
Der Sonnengott auf seiner goldenen Barke durch fährt diese
Tore, dabei begleiten ihn die drei Kräfte Hu, Sia und Heka
– Anspruch, Erkennen und Zauber. Dort,
wo die Sonne auf ihrer Fahrt durch die Unterwelt erscheint und Licht(= Leben)
spendet, erwachen Mensch und Tier aus ihrem todes
ähnlichen Schlaf; Paviane, Symbol für die jenseitigen Wesen, jubeln dem
Sonnengott zu, die Verdammten klagen über die Wiederholung ihrer Qualen. Doch
die Freude verebbt, wenn die Barke einen Bereich durchfahren hat und sich dem
nächsten bewachten Tor nähert. Finsternis senkt sich erneut herab, Mensch und
Tier stimmen die Klage an und fallen zurück in den todes
ähnlichen traum
losen Schlaf.- Solcherart sind die Darstellungen in den Gräbern vom Tal der Könige.
Wie in den
Grabräumen nicht anders zu erwarten, ist der Gott Anubis immer präsent. Anubis
ist Balsamierungsgott, Wächter der Gräber, Herr der Totenstadt und vor Osiris auch der Totengott. Dargestellt wird er in Menschengestalt mit Schakal-
oder Hundekopf; auch als großer schwarzer Hund, der auf der Mastaba
(Totenbahre) liegt. Auf den Bildern in den Gräbern neigt er sich meistens tief
über die Mumie, die er verklärt ins Jenseits aufnehmen wird.
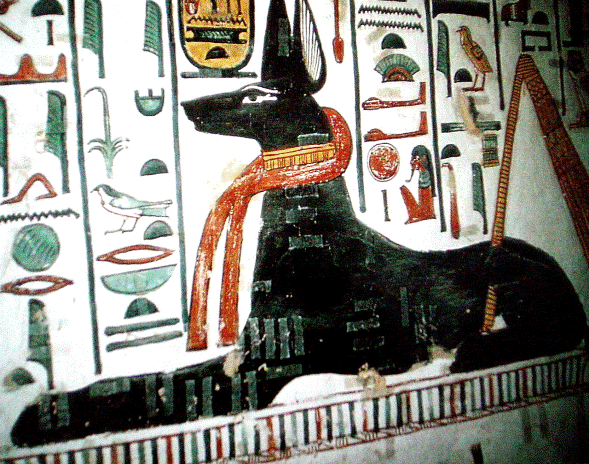
Er
„arbeitet“ bei der Einbalsamierung mit (Priester mit Schakalmaske),
begleitet die Wanderung der Seele durch die Unterwelt zu ihren Prüfungen und
ist überhaupt ständig gegenwärtig.
In den
innersten Grabkammern des Siptahgrabes fehlen die
Malereien. Nackter Fels, grob ausgehauen, formt Vorratskammern und Dienerräume.
Es berührt schmerzlich – Siptha ist zu früh
gestorben, vor der Vollendung seines Grabes.
Im
nächsten Grab geht es viele Stufen hinab, weit und tief in den Fels hinein: und
auch hier ein leerer Sarkophag – der mumifizierte Leib des Königs Setnahkt ist
nicht mehr.
Auch die
Göttin Nut, die Lebensspenderin konnte ihn nicht retten, obwohl ihr Bild auf
der Innenseite des Sarkophagdeckels eingemeißelt ist.
Wir bleiben und bewundern die künstlerisch hochrangigen Malereien, die Szenen
aus dem Ägyptischen Totenbuch wiedergeben.
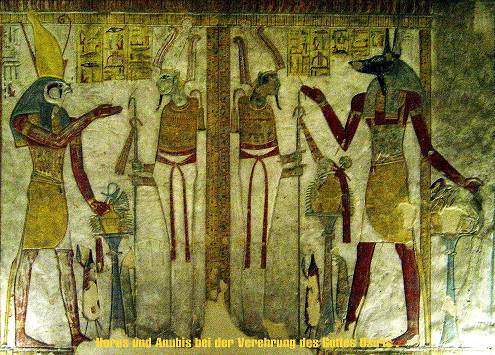
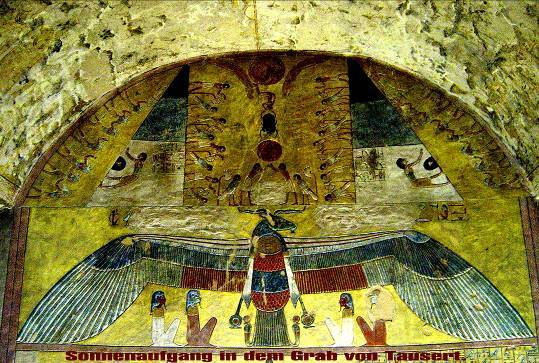
Immer
wieder erkennen wir symbolisch angedeutete Tore, neben denen große furchteinflössende Gestalten mit gezückten Messern stehen.
Der Tote muss auf seiner Wanderung zum Totengericht durch diese bewachten Tore
hindurch, wozu er sehr viel Mut und Tapferkeit braucht.

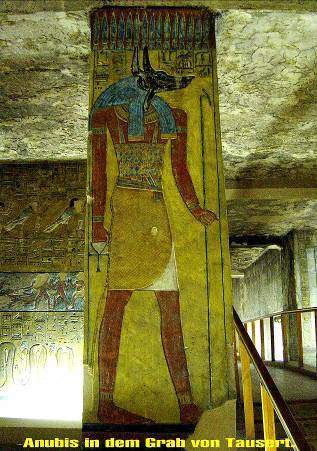
Andere
Szenen sind nicht so leicht zu dechiffrieren. Aber eine Wand, wo die
Wiedergeburt des Toten symbolisch dargestellt ist, hat sich in mein Gedächtnis
tief eingegraben
.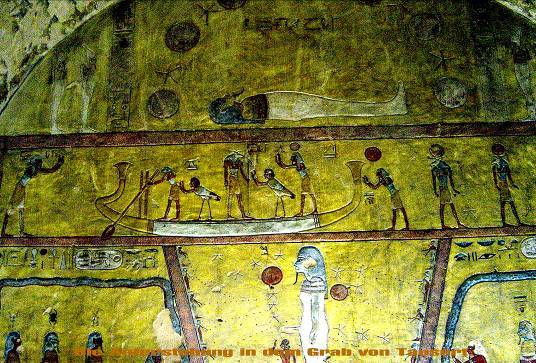
Auch die
Idee an die Pfeiler der Wand, die zur eigentlichen Grabkammer führen Seth und Amon im Kampf um den Toten
darzustellen, halte ich für einen genialen Einfall. Das Bildprogramm im
folgenden Gang entspricht wieder den sehr konkreten Jenseitserwartungen der
Ägypter. Reihen von Dienern, die Opfergaben herbeibringen, werden abgebildet,
immer besorgt darum, den Alltag des Toten
im neuen Leben möglichst zu
erleichtern. Viel zu wenig Zeit, um in der Schönheit der Darstellungen zu
versinken – genug Zeit , um einen großen Hunger nach mehr und tieferen
Verständnis dieser fremden Kultur zu entwickeln.

Wir
wandern zurück in der gleißenden Vormittagssonne, im Banne von Re, der die Erde mit seiner Kraft
erfüllt. Ich möchte hier bleiben, andere Gräber besuchen und in die Schönheit
der kunstvoll gestalteten Wandbilder eintauchen. Doch wir müssen zurück zur
Gruppe, die ohnehin schon einige Zeit auf uns warten musste. Unser Reiseführer
nimmt unsere Entschuldigung freundlich an und wir steigen wieder in die kleine
Bahn, die uns zum Taleingang zurückführt.
Jetzt
bringt uns der Bus zur obligatorischen Touristenattraktion der ökonomischen
Art, zu einer Albasterwerkstätte. Werkstätte ist gut
– es ist in Wirklichkeit ein Andenkenladen, wo alle
Arten von Steinzeug angeboten werden. Die ganze Siedlung besteht aus solchen
„Werkstätten“. Dennoch komme ich auf meine Rechnung. Ich fotografiere die
zahlreichen Familienmitglieder und habe mit ihnen gemeinsam meine Freude daran.
Schöne
Menschen sind mir näher als Alabaster und Steinzeug…




Wir
brechen auf und weiter geht es zum Totentempel der Hapschesput.
Der geniale Entwurf dieser Tempelanlage stammt vom
Baumeister Senemut,
dem Vertrauten und wohl auch Geliebten der Herrscherin. Der Totentempel besteht
aus drei übereinander liegenden
Terrassen, die durch Verbindungsrampen in eine südliche und nördliche Hälfte
geteilt werden.
In der unteren Halle stützen auf jeder Seite
22 Pfeiler das Dach, Hohlkehlen als
klassisches ägyptisches Architekturmerkmal schließen das Bauwerk nach oben
hinab.
Von der mittleren Terrasse eröffnet sich der Zugang zur
südlichen Punthalle und zur
nördlichen Geburtshalle. In der Geburtshalle finden sich Reliefs zum Werdegang
der Hatshepsut:
ihre Zeugung durch Amun,
ihre Geburt, Kinderjahre und schließlich die Krönung zum Pharao durch den thebanischen Gott.
Interessanter für die Archäologen waren zweifellos die
Szenenfolgen der Punthalle. Unter dem Karawanenführer Nehsi hatte Hatshepsut eine Expetition in das sagenumwobene Land Punt(Somalia)
geschickt, das sich einst an der somalischen Küste erstreckte und mit den
Ägyptern engen Handel betrieb. Diese gefahrvolle Reise ist in allen
Einzelheiten in der Halle dargestellt.
Die Szenenfolge beginnt an der Südwand und zeigt zunächst
bienenkorbartige Hütten des fremden Volkes, die am Meeresstrand zwischen Palmen errichtet sind. Der
ägyptische Expetitionsleiter wird vom puntischen Herrscher freundlich begrüßt – die Entgegennahme
der Gastgeschenke ist über dieser Szenerie abgebildet. Daneben erscheint die
offensichtlich kranke Fürstin des Volkes von Punt, dargstellt
mit Fettpolstern und in verkrümmter Haltung, die auf einem Esel daher geritten
kommt und mit schmerzlicher Miene den ägyptischen Kaufleuten Reverenz erweist.
Darüber sehen wir, wie ägyptische Schiffe beladen werden und sich im Wasser tummelnden Fische, die
derartig exakt gezeichnet sind, sodass sie moderne Forscher identifizieren und
über ihr Verbreitungsgebiet die Lage des Landes Punt lokalisieren konnten.
Die westliche Längswand zeigt weiterhin die Beladung der
ägyptischen Schiffe – und das in allen Einzelheiten. Matrosen arbeiten konzentriert
mit dem Tauwerk, einige Affen vergnügen sich in der Takelage und auf den
Masten. Wie am Fließband bringen Träger die Waren an Bord, Aufseher rufen
Befehle, winken und versuchen, den Handelsstrom in geordnete Bahnen zu lenken.
Schließlich sieht man die Schiffe, die mit geblähten Segeln die Heimreise
antreten.
Hatshspsut,
als Mann dargestellt, begutachtet nach der glücklichen Heimkehr der Expetition die mitgebrachten Waren und lässt sie vom
Schreibergott Thot registrieren.
An der Nordwand ist Hatshspsut
zusammen mit ihrem Ka unter einem Thronbaldachin abgebildet. Die Texte erzählen
von den Befehlen der Herrscherin an ihre Getreuen.
An die Punthalle schließt sich am
Ende einer der Hathor geweihte Kapelle. Hathor- Säulen mit dem Gesicht der Göttin an den Kapitellen
schmücken das kleine Heiligtum.
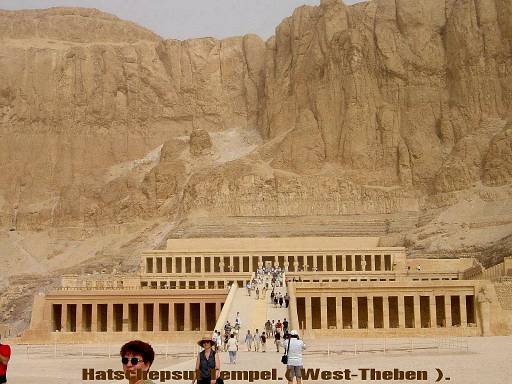
Gut, dass
ich schon viel weiß und zielgerichtet meine bevorzugten Räume besichtigen kann.
Zuerst bleiben wir in der rechten Anubiskapelle und
betrachten die Bilder von Thurmosis III. Es sind gut
erhaltene farbige Gestalten, die sich in
dem kleinen Raum vor unseren Augen präsentieren und uns sogar den Sternenhimmel
herunterholen mit blauer Deckenfarbe, die mit gelben Sternen übermalt ist. Die
Sternendecke gehörte zum Kanon einer ägyptischen
Tempelausstattung
, die Himmel und Erde umfasst.

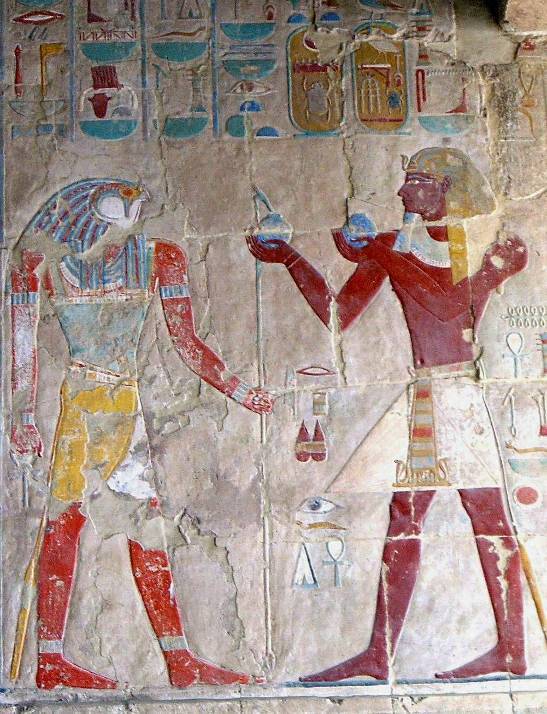
Die Geburtshalle gibt nicht wirklich viel her. Die Farben
sind ausgebleicht und die Entfernung von den Reliefs zu weit, um aus den verbleibenden
Umrissen Inhalte ablesen zu können, wie z. b. den rituellen Vogelfang.
So laufen
wir hinüber zur Punthalle und hier ist alles so, wie
beschrieben: Die Kuppelhäuser der Einheimischen, die Beladung der Schiffe-
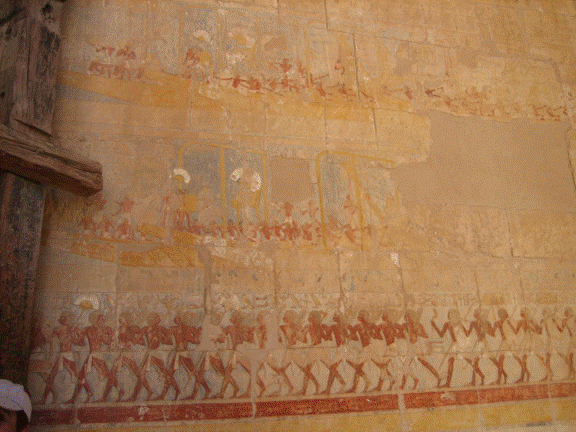

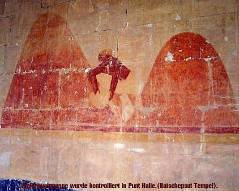
Die
Begrüßung des ägyptischen Beamten – alles sehr lebendig und klar gezeichnet.
Aber auch hier sind die Farben
weitgehend ausgebleicht, aber doch noch besser sichtbar, als in der Geburtshalle.

Begrüßung
der ägyptischen Beamten
|
|
|
Die kleine
Hathorkapelle an der linken Tempelseite ist ein Juwel
der besonderen Art. Bunt bemalt fasziniert dieses kleine Heiligtum bis heute.
Im Vorraum stützen Hathorsäulen das fehlende Gewölbe
.

An der
Westwand finden wir ein künstlerisch überragendes Bild von der Göttin Hathor als säugende Mutterkuh.

Auch der
kämpfende Tutmosis an der Ostwand ist von begabter Hand gemalt. Langsam
erweitert sich mein Verständnis für Einzelheiten und Unterschiede in den
tradierten Darstellungen, die trotz festgelegten Schema durch künstlerisches
Können lebendige Formen annehmen

Dann geht
es im Eilschritt hinunter zum Treffpunkt mit den Anderen. Obwohl es mich
anfangs seltsam anrührt, ist die kurze Fahrt im Elektro-Zug ein angenehmer
Zeitraum – um die Eindrücke ein wenig zu sammeln, bevor wir den Andenkenbazar der Länge nach durchwandern müssen. Wie
Insekten schwirren die Händler heran und herum – und das „La! Schukran!“ (Nein, danke!) wird fast zu einer Litaneiantwort beim Durchqueren dieser „Einkaufsmeile“.
Im Bus
geht es zurück entlang eines kleinen Nilarms und ich sehe
beim zufälligen Aufblicken mein erstes Krokodil in freier Wildbahn.
Dann sind
wir wieder zurück am Schiff und gehen zum Mittagessen.
Ein Wort
dazu: abwechslungsreich, excellent, schmackhaft und
jeden Tag mit neuen Köstlichkeiten ergänzt. Man müsste die Feder eines Trimalchios führen können, um schon das Frühstück zu
beschreiben: Eiergerichte, warme Fleischgerichte – verschiedene Käse –
Geflügelwurst – Obst von exzellentem Geschmack – Süßigkeiten und Brot in vielen
Varianten, weich und süß…
Mittagessen:
Gemüsegerichte der feinsten Sorte – Fisch einmal in Soßen, dann natur gebraten, Fleischgerichte in verschiedenen
schmackhaften Soßen. Dazu gibt es Reis, Nudel und Salate. Die süßen Nachspeisen
sind mir allerdings etwas zu üppig: orientalische Küche pur.

Am Abend
klingen die Schreie der Esel quer über den Strom bis zu uns an Deck. Jetzt um
21 Uhr tönt aus vier Minaretts der Ruf der Muezzins übers Wasser. Dieser Klang
lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Menschliche Stimme in verschiedenen
Schattierungen, ein Ruf worin auch die Transzendenz mitschwingt: einfach,
schlicht und selbstverständlich. Damit wird wirklich Gott gelobt. Die Minaretts
sind nachts mit grünen Lampen beleuchtet – schlanke Erinnerungen daran, dass
noch immer Gott die Welt in der Hand hält und nicht wir…
Karnak bei Nacht.
Wir
wandern über eine weite Terrasse – noch ganz eingetaucht in private Gespräche.
Doch schließlich stehen wir vor dem unbeleuchteten Eingangspylon des Karnaktempels. Vor uns zwei Widderreihen aus Stein, die die
Tempelstraße bewachen. Nur Priester im
Dienst und Pharao durften diese Straße betreten. DasVolk
hatte niemals Zutritt zum Tempel, während der langen Perioden der ägyptischen
Vergangenheit.
Der äußere
Pylon blieb unvollendet: der Pharao, der sich entschloss dieses mächtige
Bauwerk zu errichten, starb zu früh.
Doch jetzt
geht ein Atmen durch die Menge. Lichtbündel heben die Fassade des Pylons aus der Dunkelheit und die Widderköpfe beginnen
plötzlich zu leuchten:
ein
überwältigendes Bild.

Die
Kameras blitzen – doch dazu braucht man eine Spezialausrüstung, um diese
überwältigende Schönheit ins Bild zu bannen. Gleichzeitig beginnen zwei
ausgewählte, fabelhafte Sprecher in großen geistigen Bögen –ausgehend von der
Tempelanlage – ägyptischen Geschichte zu erzählen.
„Wir sind
angekommen, angekommen im Hause des Vaters, Amun…“
So
beginnen sie. Hier war er zu Hause, der Vatergott Ägyptens. Hier dienten ihm 24
Kasten von Priestern – hierher kam Pharao um ihm zu opfern. Und zum Opetfest wurde die Kultfigur des Gottes auf
einer Barke flussaufwärts gerudert zum Tempel von Mut, seiner Frau. Nur bei diesem Fest konnte das Volk „dabei sein“,
zumindest von weitem mit seinem Gott in Kontakt kommen.
Drei Tage
dauerte das Fest … und ein Jubel ohnegleichen begrüßte die göttliche Barke,
wenn sie aus dem Kanal des Tempelbezirkes kommend in das breite Wasser des
Heiligen Nil einbog.
Nach den
Einführungsworten wird plötzlich eine Kette gelöst und wir dürfen auf dem
widderflankierten Tempelweg hinaufsteigen zum mächtigen Eingangspylon, durch
ihn hindurch und in den ersten Hof, wo wieder die Stimmen hören, die uns über
das Bauwerk linker Hand berichten, einem Tempel zu Ehren der thebanischen Trias:Amun, Mut und Chons, der vom Pharao Sethos
II errichtet wurde.
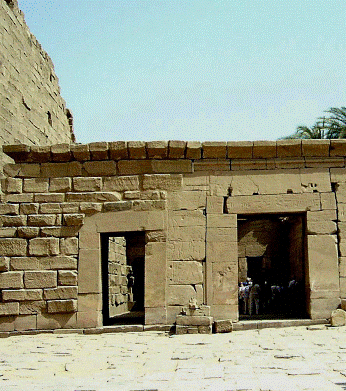
Rechter
Hand erhebt sich der Eingangspylon des Amontempel,
der von Ramses II errichtet wurde. Dort gleiten die
Strahlen der Scheinwerfer über die Osirispfeiler –
Symbol der immerwährenden Gegenwart des Gottes – symbolisiert durch Fels und
Stein.
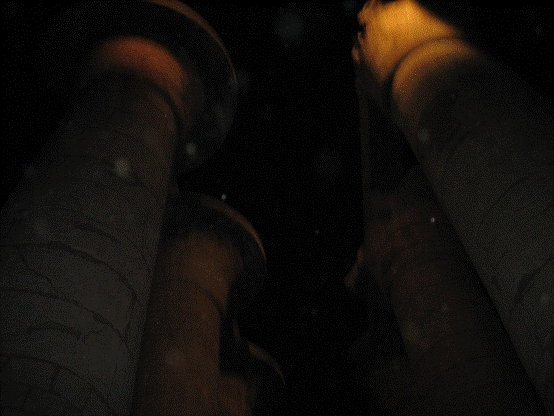

Mit dieser
Tempelanlage hat sich Ramses II ein Denkmal gesetzt,
das in seiner
Großartigkeit
nicht zu wünschen übrig lässt. Noch umfängt uns der Zauber des völlig Neuen und
Unerwarteten und dieses Gefühl wird noch gesteigert beim Betreten des
nächsten Raumes. Hier umgibt uns ein riesiger Säulenwald –
spärlich erhellt durch Lichtbündel, die die mystische Atmosphäre noch steigern.
Dazu fügen sich die Stimmen der Sprecher in den Raum, die erzählend den
Säulenwald zum geistigen Leben erwecken. Ich schlendere durch das
Säulenlabyrinth und versuche ein Stück Einsamkeit zu gewinnen, um den
gewaltigen Eindruck innerlich verarbeiten zu können. Eines ist mir schon jetzt
klar: dieser Raum wird mit unvergesslich bleiben.
Weiter
führt uns eine hellgekleidete Gestalt entlang der hieroglyphenge
- schmückten Außenmauer des Amontempels. Sie ist noch
warm von der gesammelten Sonnenhitze des Tages. Die Kanten der gemeißelten
Texte fühlen sich rau an und es tut gut zu wissen, dass die Gelehrten diese
Texte wirklich lesen können. Denn nur die Schrift kann das Dunkel um versunkene
Welten und Völker erhellen. Ägypten hat es geschafft uns zu den gewaltigen
Bauwerken einen Schlüssel zu übergeben, und zwar in Form eines mehrsprachigen
Steines, der uns das Geheimnis ihrer Tempeltexte zu enthüllen erlaubt.

Im
Augenblick, wo wir auf der Terrasse ankommen, die sich nördlich des Heiligen
Sees aufbaut, erstreckt sich das beeindruckende Panorama der Tempelstadt vor uns.
Unter uns glitzert der See geheimnisvoll, als wollte er einladen, dem
mystischen Zauber des rituellen Bades nachzuträumen,
dem sich der Pharao immer wieder unterziehen musste, um gereinigt uns geläutert
dem Amun-Vater huldigen zu dürfen.
Wir nehmen auf der Terrasse auf
weißgepolsterten Sitzen Platz und versinken in der Schönheit des weiten, von
wechselnden Lichtern erhellten architektonischen Raums. Wir lauschen dem
poetischen Bericht vom Aufstieg der größten antiken Macht und schließlich vom
Verblühen einer Kultur, die so konzentriert war auf das Festhalten des Lebens
über den Tod hinaus.
Schon bei
der Krönung des Pharaos begann seine Sorge um das ewige Leben, indem sofort mit
dem Bau seiner persönlichen Grabanlage begonnen wurde.
So wollte
er sich sichern gegen die Katastrophe jeden menschlichen Lebens, die
fundamentale Kränkung durch den Tod. Gleichzeitig geschah vieles, um das
irdische Leben in seiner vielfältigen Lust zu erhalten und zu genießen. Der
Vatergott Amun, wie auch die anderen Götter der Trias
sollten Garantien erwirken für das irdische Leben: Leben in Fülle weitergeben
an die Nachkommen, die trotz ihrer persönlichen Selbständigkeit, immer auch
Elemente von uns selber sind und bleiben.
Der Tempel
von Karnak,
der über viele Generationen erbaut,
erweitert und geschmückt wurde, erscheint uns heute als beeindruckendes Denkmal
der Beständigkeit innerhalb der ägyptischen dynastischen Geistigkeit. Wir
besuchen die Tempelanlage am Tag nach unserem Abendbesuch und beginnen uns mit
der Entstehungsgeschichte und den Details der Anlage auseinander zu setzen.
Die mit Abstand größte Tempelanlage von Ägypten, wurde immer
wieder hymnisch besungen. Jeder Herrscher sah es als Teil seiner göttlichen
Pflichten an, an dem Komplex weiterzubauen. Geweiht war Karnak
dem thebanischen Reichsgott Amun,
der ab der 11.Dynastie bis tief in die römische Ära hinein, hier Verehrung
fand.
Eine Widdersphingenallee führt auf
das Tor des ersten Pylon zu; der Widder war eines der Attribute des Gottes Amun. Nie wurde in Ägypten eingrößerer
Pylon gebaut, der mit einer Breite von 113m und einer Höhe von 43m und einer Dicke von 15m alle bekannten
Dimensionen sprengt.
Der große Vorhof hinter dem ersten Pylon ist nicht weniger
eindrucksvoll. Gleich links befindet sich ein kleines Heiligtum für die thebanische Götterfamilie Amun,
Mut und Chons, das auf Sethos
II. zurückgeht. Rechts und quer zur Tempelachse hat Ramses
II. für die drei Gottheiten einen weiteren Tempel errichten lassen. Dessen
Vorhof schmücken 20 Osirispfeiler, die anschließende
Querhalle wird von vier Säulen dominiert und der Saal vor dem Sanktuarium von acht Säulen getragen. Das Allerheiligste
ist dreigeteilt, so dass in je einem Abschnitt der Reichsgott Amun, seine Gemahlin Mut und der Göttersohn Chons verehrt werden
konnte.
Der kleine Pylon zeigt das unverzichtbare Niederschlagen der
Feinde, und damit die Herstellung der kosmischen Ordnung. Auf dessen Rückseite
überträgt Amun Ramses die
göttliche Königswürde; an den Wänden sind heilige Prozessionen dargestellt,
weiter hinten Ramses bei der Opferung vor der
Götterbarke.
Bemerkenswert die hohe Säule des Taharqua,
in Auftrag gegeben von dem gleichnamigen Herrscher, die als Einzige im großen
Vorhof übrig geblieben ist. Davon wenig entfernt steht
die von Ramses ursupierte
riesenhafte Statue des Pinodjem, die Attraktion des
ersten Vorhofes.
Ein Tor im Norden führt in ein kleines Freilichtmuseum,
worin eine Anzahl von Blöcken ausgestellt sind, die noch lange den Archäologen
für Forschungen dienen werden.
In diesem Areal befindet sich die Rote Kapelle der Hatschepsut und ein weiteres kleines Heiligtum von Sosestris I., das zu den ältesten Teilen der Tempelanlage
zählt.
Ein hohes Tor führt vom Vorhof durch den zweiten arg in
Mitleidenschaft gezogenen Pylon
und hinein in den großen Säulensaal. Dieser dichte
Säulenwald ist gleichzeitig monumental
und doch von einer Anmut, wie sie kein anderes Denkmal dieser Welt
besitzt.
134 Säulen, davon zwölf Doldensäulen und 122 Papyrosbündelsäulen, wachsen in 16 Reihen in die Höhe.
Säulen und Wände sind über und über mit Hieroglyphen verziert.
Die nördliche Außenwand zeigt in ihren Bildfolgen die Siege Sethos I., die südliche Außenwand RamsesII.
bei seinen Kämpfen gegen die asiatischen Nachbarn.
Der dritte Pylon ist nur in seinen Ansätzen zu erkennen. Vor
dem vierten Pylon streckt sich die Nadel des Thutmosis
I. in den Himmel. Ursprünglich standen hier ein weiterer Obelisk des gleichen
Herrschers sowie zwei von Thutmosis III.
Der vierte Pylon mit der anschließenden Säulenhalle ist
ebenfalls nur noch an den Fundamenten zu erahnen. Blickfang ist hier der
Obelisk der Hatshepsut. Auch er besaß einst einen Zwilling, dessen Spitze heute
am heiligen See liegt. Heute der höchste aufgestellte
Obelisk in Ägypten. (Die Laterannadel ist 1,2 m
höher). Gut erkennbar, die von Echnaton in Auftrag
gegebene Namenstilgung des Gottes Amun; Sethos hat die Inschriften allerdings wieder einsetzen
lassen. Gut erkennbar das Ziegelwerk, womit Thutmosis
III. den Obelisken der Hatshepsut hat einmauern lassen. Dank dieser Maßnahme
hat die steinerne Nadel die Jahrtausende gut überdauert.
Hinter dem fünften
Pylon liegen zwei ehemalige Vorhallen in Ruinen. Ebenfalls weitgehend zerstört
ist der sechste Pylon. Die anschließende Halle zeigt zwei interessante Pfeiler;
der rechte trägt eine Lilie, die Wappenpflanze für Oberägypten, die linke ist
mit einem Papyrosstengel verziert, dem Zeichen für
Unterägypten. Jenseits der Halle liegt das Allerheiligste, umgeben von dem so
genannten Annalensaal mit einer Reihe von Inschriften
sowie den üblichen Nebenkammern, apostrophiert als Gemächer der Hatshepsut.
Das aus zwei Räumen bestehende Sanktuarium ließ der
makedonische Nachfolger von Alexander d. Gr., Philipp
Arrhidaidos aus Rosengranit anlegen. Teilweise
schimmert noch die originale Farbe der
Reliefs im Dunkel. Auch der Opfertisch für die Götterbarke steht noch immer am
Platz. Im ersten und zweiten Raum sind Szenen abgebildet, die Philipp zeigen,
wie er den Göttern opfert.
Weiter in Richtung Tempelachse erstreckt sich ein weites
Trümmerfeld. Dahinter die Festhalle von Thutmosis
III. Der quer zur Tempelachse ausgerichtete Saal wird durch 52 Zeltstangen-säulen und Pfeiler gegliedert, die blaue Bemalung der Decke
ist noch immer gut sichtbar.
Bemerkenswert die Reliefs des Botanischen Gartens. An
den halbhohen Wänden hat Thutmosis alle jene Tiere und Pflanzen abbilden lassen, die
er von seinen asiatischen Kriegszügen mitgebracht hat.
Der Obiliskentempel, heute nur
mehr in Resten vorhanden, wurde von Thutmosis III.
begonnen, Ramses II. führte fort. Fertiggestellt
wurde der Tempel während der Regierungszeit von Taharka.(die
namensgebende Steinnadel ließ Kaiser Constantius 357
im Zirkus Maximus aufstellen; 1587 ordnete Papst
Sixtus die Umsetzung vor den Lateranpalast an.)
Direkt an der nördlichen Ziegelumwallung lohnt der kleine Ptahtempel einen Besuch. Bauwerk, von Thutmosis
III. hat das Bauwerk in Auftrag
gegeben. Kompositsäulen
gliedern den Hof; nach einer Vorhalle ist das dreigeteilte Sanktuarium
erreicht, worin das sitzende Kult bild des Ptah (ohne Kopf) noch vorhanden ist. Ihm zur Seite die
löwenköpfige Sechmet, seine Gemahlin. Jenseites der Ziegelmauer liegen die Reste eines Month-Tempels.
Der Besuch
am Morgen „danach“ im Tempel von Karnak erweist sich
für mich wie der Besuch bei einer faszinierenden Schauspielerin, die man nach
einem berührenden Theaterabend, wo sie alle mit ihrer Schönheit bezauberte, in
Alltagskleidern und ungeschminkt wieder trifft. Jetzt halte ich mich an den
Text des Polyglottführers und versuche mir die Anlage
im Detail einzuprägen. Doch es gelingt nicht wirklich. Vorbei an den Osirissäulen, die auch am Tag ihre Faszination nicht
verloren haben, wandere ich zum Heiligen See, der sich jetzt dunkel und brackig vor mir ausbreitet, an seinen Ufern mit Müll
bedeckt. Schnell gehe ich vorbei und wende mich zu den Ausgrabungen im Osten,
wo nur ein einzelner Mann Wache hält. Er führt mich zur Rückseite des vierten
Pylon, wo es ruhig und menschenleer ist. Hier gelingt es mir ein bisschen von
dem Zauber nachzuempfinden, der am Abend davor so stark gewirkt hat.



Auch das
Labyrinth bleibt faszinierend mit seinem hohen Säulenwald, wo ich jetzt
Einzelheiten der Reliefs betrachten kann, die nachts unsichtbar waren. Ich
schlendere herum und versinke aber immer mehr in ein Gefühl der Melancholie.
Später an der usurpierten Ramsesstatue reißt mich ein
kunstverständiger Führer aus meiner Stimmung, indem er auf die feine
künstlerische Arbeit hinweist, womit das bekannte Bild der Verbindung von Ober-
und Unterägypten in Form von Papyros- und Lotosstengel an
den Seitenwänden des Königsthrones gearbeitet ist. Die Klarheit der Linien, die
feine Arbeit der Details erfreuen mein Auge und ich kann wieder auftauchen aus
der Traurigkeit, die mich hier immer wieder umfangen hat.
Auch RILKE hat hier geweilt und schreibt:
Diese unbegreifliche Tempelwelt von Karnak,
die ich gleich am ersten Abend und gestern wieder im eben erst abnehmenden
Monde sah, sah, sah – mein Gott man nimmt sich zusammen, sieht mit allem Glaubenwollen beider eingestellten Augen – und doch beginnts über ihnen, reicht überall über sie fort (nur ein
Gott kann ein solches Sehfeld bestellen)
-
da steht eine Kelchsäule, einzeln, eine überlebende, und man
umfasst sie nicht, so steht sie einem über das Leben hinaus, nur mit der Nacht
zusammen erfasst mans irgendwie, nimmt es im ganzen
mit den Sternen, von ihnen aus wird es für eine Sekunde menschlich,
menschliches Erlebnis.
|
|
|
In Karnaks wars. Wir warn hingeritten
Helene und ich, nach eiligem diner.
der Dragomann
hielt an: die Sphinxallee –
ah! Der Pylon: nie war ich so
inmitten
mondender Welt! (Ist`s möglich,
du vermehrst
dich in mir, Großheit, damals schon zu viel!)
ist Reisen – Suchen? Nun, das
war ein Ziel.
Der Wächter an dem Eingang gab
uns erst
des Maßes Schreck. Wie stand er
niedrig neben
dem unaufhörlichem
Sich-überheben
des Tors. Und jetzt für unser
ganzes Leben,
die Säule - : jene ! war es
nicht genug?
Zerstörung gab ihr recht: dem
höchsten Dache
war sie zu hoch. Sie überstand
und trug Ägyptens Nacht.
der folgende Fellache
blieb nun zurück. Wir brauchten
eine Zeit,
dies auszuhalten, weil es fast
zerstörte,
das solches Ringen dem Dasein
angehörte,
in dem wir starben.- Hätt ich
einen Sohn,
ich schickt ihn hin, in jenem
Wendejahre,
da einer sich entringt ums
einzig Wahre.
„Dort ist es, Charles,- geh
durch den Pylon
und steh und schau…“
Uns half es nicht mehr, wie?
Dass wirs
ertrugen, war schon viel. Wir Beide:
du Leidende, in deinem
Reisekleide
und ich, Hermit
in meiner Theorie
und doch die Gnade! Weißt Du
noch den See,
um den granitne
Katzen-Bilder saßen,
Marksteine – wessen? Und man
war dermaßen
gebannt ins eingezauberte
Carre,
dass, wären fünf an einer Seite
nicht
gestürzt gewesen (du auch sahst
dich um),
sie, wie sie waren, katzig, steinern, stumm,
Gericht gehalten hätten. Voll
Gericht
war dieses alles. Hier der Bann
am Teich
und dort am Rand die Riesen Skarabäe
und an den Wänden längs die Epopäe
der Könige: Gericht. Und doch
zugleich
ein Freispruch ungeheuer. Wie
Figur
sich nach Figur mit reinem
Mondschein füllte,
war das im klarsten Umriss ausgedüllte
Relief, in seiner muldigen Natur,
so sehr Gefäß - - -: und hier
war das gefasst,
was nie verborgen war und nie
gelesen:
der Welt Geheimnis, so geheim
im Wesen,
dass es in kein Verheimlicht –
Werden passt!
Bücher verblätterns
alle: keiner las
so Offenbares je in einem Buche
-,
(was hülfts,
dass ich nach einem Namen suche):
Das Unermessliche kam in das
Maß
der Opferung.- Oh sieh, was ist
Besitz,
solang er nicht versteht, sich
darzubringen?
die Dinge gehen vorüber. Hülf
den Dingen
in ihrem Gang. Dass nicht aus
einem Ritz
dein Leben rinne. Sondern
immerzu
sei du der Geber. Maultier
drängt und Kuh
zur Stelle, wo des Königs
Ebenbild
der Gott, wie ein gestilltes
Kind, gestillt
hinnimmt und lächelt. Seinem
Heiligtume
geht nie der Atem aus. Er nimmt
und nimmt
und doch ist solche Milderung
bestimmt,
dass die Prinzessin die Papyros – Blume
oft nur umfasst, statt sie zu
brechen.-
Hier
Sind alle Opfer – Gänge
unterbrochen
Der Sonntag rafft sich auf, die
langen Wochen
verstehn in nicht. Da schleppen Mensch
und Tier
abseits Gewinne, die der Gott
nicht weiß.
Geschäft, mags
schwierg sein, es ist bezwinglich;
Man übts
und übts, die Erde wird erschwinglich,-
Wer aber nur den Preis gibt,
der gibt preis.
RILKE 1921 Schloß Berg
am Irchel

Weiter
geht es zu einem „Papyrosmuseum“. Hinter diesem
hochtrabende Titel verbirgt sich wieder ein Geschäft, das verschiedene Sujets
aus Ägyptens Vergangenheit anbietet, und zwar auf Papyros
gedruckt oder gemalt.
Ob es sich
dabei wirklich um Papyros handelt, wage ich zu
bezweifeln. Aber die Anderen freut es und dann ist es schon recht.
Der Luxor
Tempel
Der Tempel
der Mut, den wir später besuchen, ist ein weniger imposantes Gebäude als der
Tempel ihres Eheherrns Amun.
Alles ist kleiner, die Säulenreihen enger gestellt – doch macht der Tempel
insgesamt einen heimeligeren Eindruck, wenn dieser Ausdruck hier überhaupt
angebracht ist.
Amenophis
III gab den Auftrag für den Bau der sakralen Stätte und ersetzte damit ein
älteres
kleineres Heiligtum. Gewidmet ist es der thebanische
Göttertrinität: Amun, Mut und Chons.
Alle späteren
Herrscher nahmen Veränderungen vor und erweiterten Tempel
kontinuierlich, bis er schließlich auf eine Länge von 260m angewachsen war.
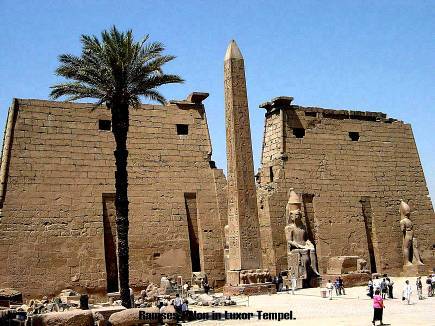
Der erste Pylon geht auf die unermüdliche Bauinitiative von Ramses II. zurück. Wie nicht anders zu erwarten, ist dieser
63m breite Torturm mit Reliefs der Schlacht von Kaddesh geschmückt, die Ramses
gegen die Hethiter führte. Die Bilder im rechten Teil der Pylons
zeigen den Pharao bei der Strategiebesprechung mit seinem Heerführern, das
ägyptische Truppenlager, wie es gerade von den anrückenden Hethitern
angegriffen wird und schließlich den großen König auf seinem Streitwagen. Die
linke Turmseite ist den eigentlichen Kämpfen vorbehalten. Ramses
tobt inmitten seiner Feinde und schlägt sie in die Flucht; wer dem rasenden
König entkommt, sucht die Sicherheit der Festung Kaddish
zu erreichen.
Schließlich muss auch der Hethiter-Herrscher Mutwatallis Fersengeld geben; erschrocken dreht er sich
nach Ramses um. Die Texte lobpreisen seinen großen
Sieg, von dem jeder weiß, dass es nicht einmal ein kleiner war.
Einst standen sechs steinerne Abbilder des großen Pharaos
vor dem Pylon, erhalten geblieben sind heute nur noch, zwei Sitzfiguren von
14m Höhe sowie eine stehende Statue.
Zusätzlich dazu ritzten hier einmal zwei Obelisken den Augapfel der Sonne, seit
1836 ziert eine dieser Nadeln die Place de la Concorde in Paris.

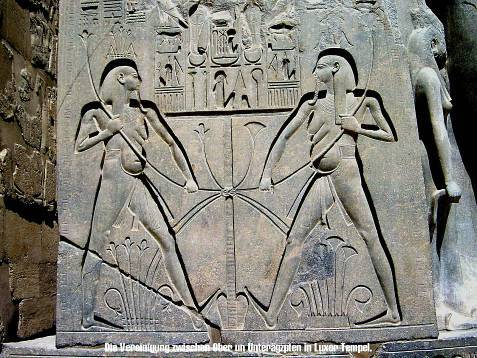

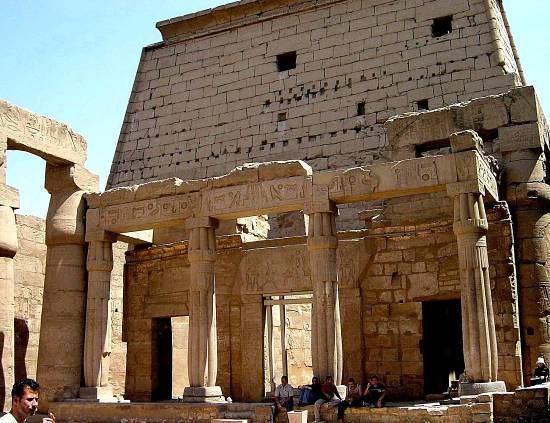
Hinter dem Pylon breitet sich der große kolonnadengesäumte
Säulenhof von Ramses II. aus.
74 Papyrosbündelsäulen stützen
einst die Decke, dazwischen sind 7m hohe Statuen von Ramses
II. aufgestellt. In der Nordostecke ragt die sehr verehrte Moschee des Abu al Haggag in den Komplex hinein.
Besondere
Beachtung verdient ein Relief an der rechten Südwand. Hier sehen wir die
originale Fassade des Tempels mit dem flaggengeschmückten Pylon, den sechs
Standbildern sowie den beiden Obelisken davor. Ein langer, prachtvoller
Prozessionszug mit geschmückten Tieren, vielen Opfergaben und gravitätisch
einher schreitenden Priestern nähert sich dem Heiligtum.
Ein Tor
flankiert von zwei mächtigen Statuen, führt in den langen Säulengang, den Amenophis dem Tempel vorsetzen ließ. 14 paarweise
angeordnete Papyrosbündelsäulen tragen noch heute
gewaltige Architrave. Die Reliefs gehen auf Tut-ench-Amun zurück und zeigten die Feiern zum Opet-Fest.
Heute weitgehend durch Umwelteinflüsse zerstört.
Der zweite
Hof, von einer zweireihigen Kolonnadenreihe umgeben,
leitet in die Vorhalle des Tempels über, die von je acht Säulen in vier Reihen
gegliedert wird. Diese insgesamt 32 Papyrosbündelsäulen
sind reich verziehrt; die Wände zeigen religiöse
Szenen.
Den
folgenden Vorsaal ließ Diokletian zu einem römischen
Tempel umbauen. Dieses sogenannte Sacellum gehörte zu
dem römischen Truppenlager, das in Luxor stationiert war.
Weiter
geht es der Tempelachse folgend durch einen, weiteren Saal mit vier Säulen, in
dem der Opfertisch für die heilige Barke stand. Und schließlich in das
Allerheiligste, dessen heutige Anlage auf Alexander den Großen zurückgeht. Der
geniale Stratege ließ vier Säulen entfernen und einen granitenen Schrein
errichten. Die Reliefs an den Stirnseiten zeigen den König im Sanktuarium bei
kultischen Handlungen und seine Krönung durch Amun,
die Seitenwände geben religiöse Riten wieder .
Es folgen
ein weiterer, quer zur Tempelachse liegender Opfertischsaal mit 12 Säulen,
woran sich drei kleine Kapellen
anschließen.
Besonders
bemerkenswert sind die Bildfolgen im Geburtsraum, einem Vorläufer für die in
späteren Zeiten den Tempeln angegliederten Mammisi.
Seinen Namen hat die Halle von den Reliefs der Westwand bekommen. Obwohl nicht
mehr wirklich deutlich sichtbar, ist die Geschichte, die hier gezeigt wird von
hohem kulturhistorischem Rang: (von links nach rechts)
Chnum
erschafft auf seiner Töpferscheibe zwei Knaben (Amenophis
und sein Ka), ihm gegenüber Isis; die Götter Chnum
und Amun; Amun mit Mutenweje, der Mutter von Amenophis,
auf der Hieroglyphe Himmel und gehalten von den Göttinnen Seiket
und Neith; Amun und Thot; der König und Amun; Isis
umarmt von Amun Mutenweje.
Mittlere
Reihe: Thot kündigt Mutenweje
die Geburt eines Sohnes an; die schwangere Mutenweje
zusammen mit Isis und Chum; Mutenweje
schenkt einem Jungen das Leben, sie wird von den Göttern, besonders Bes und Toeris, den Beschützerinnen der Schwangeren, bewacht. Isis reicht das Neugeborene Amun; im Beisein von Hathor und
Mut nimmt Amun den Knaben auf den Arm.
Obere
Reihe: Die Göttin Seiket, vor ihr die Königin, zwei
Göttinnen stillen den jungen Prinzen und sein Ka; eine Reihe von Gottheiten
tragen das Baby Amenophis; Gott Hekau
hält den Prinzen und sein Ka auf dem Arm, hinter ihm der Gott des Nil; Horus
übergibt die beiden an Amun; Chnum
und Anubis; der Prinz und sein Ka vor Amun; Amenophis als König.
Unter dem
Schutz der Götter kommt das Kind zur Welt, wird von Amun
gestillt und dem Schöpfer präsentiert, der den Knaben als Sohn anerkennt und
zum König krönt. Hierin liegt der Kern der göttlichen Natur des Pharaos.
Die
Szenenfolge in der Mammisi (Geburtshalle)beleuchten
ganz klar den Hintergund des überwältigend langen
Bestandes des ägyptischen Großreiches, und zwar in politischer Hinsicht. Das
Wohl des Reiches war nicht an bestimmte Personen gekoppelt- obwohl Gestalten
wie Ramses II dem Reich einen sichtbaren und
bleibende Stempel aufgedrückt haben. Die Kontur des Pharao konnte immer wieder
durch neue Geschlechter ausgefüllt werden. Wesentlich war nur, dass man seitens der Priester glaubhaft machen konnte,
dass der zukünftige Pharao göttlichen Ursprungs ist. Und wer wollte sich dieser
Interpretation widersetzen?
Ich
wandere durch die künstlerisch sehr eindrucksvoll gestalteten Säulenhalle hinein in das Innere des Tempels.
In der Tempelvorhalle berührt mich eine runde Apsisnische
sehr vertraut – sie war Teil eines römischen
Heiligtums für die Soldaten des nahe stationierten Heerlagers. In den
Räumen, wo die Opfergaben aufbewahrt wurden, gibt es noch einige gut erhaltene
farbige Reliefs, die schon auf den ersten Blick einen Zusammenhang herstellen
lassen, womit eine Deutung wesentlich einfacher
und schneller gelingt.

Es sind
immer wiederkehrende Szenen, wie die Opferungsgesten der Pharaonen gegenüber
den verschiedenen Göttern. Sie opfern Blumen, Nahrungsmittel, Gefäße mit Wein
oder bringen Rauchopfer dar. Daneben wiederholen sich die Darstellungen, wo
Götter den Pharao segnen. Alles wirkt wie eine großangelegte bildlich
gestaltete Litanei, die in allen Tempeln wiederkehrt.
Den
stärksten Eindruck nehme ich von den Säulenhallen mit, die in den Maßen
harmonisch gestalteten Papyrossäulen, die so fremd
und gleichzeitig so vertraut anmuten, weil sie
ihrem Naturvorbild so unmittelbar entsprechen. Später versuche das
Gesehene innerlich zu ordnen, während ich mich an eine dieser Säulen anlehne
und Wärme und Schönheit zugleich genieße.

Zurück an
Bord, erleben wir das erste Mal, dass sich unser schwimmendes Hotel bewegt. Wir legen ab und nun beginnt die
langsame Fahrt flussaufwärts, die uns immer wieder malerische Bilder vor Augen
führt. Einmal sind es Palmenhaine dann wieder Felder mit Zuckerrohr – dazwischen
grüne Hartlaubgewächse, dann wieder
Häuser oder auch Schilfhüten, die an den Ufergestaden ab und zu auftauchen und
wieder versinken.Da sich der Fluss noch selbst seine
Ufer gestaltet, kommen manchmal raue Erdabrüche in den Blick, dann wieder buchtförmigen Ausweitungen, die mit Schilf
bewachsen sind – und immer wieder Inseln, die sehr malerisch daliegen und hin
und wieder bewohnt sind.

Ich
zeichne und fotografiere und möchte keinen der Blick auf die faszinierende Uferlandschaft
versäumen; einer Zeit intensiver Begegnung mit Natur und Landschaft.

Am späten
Nachmittag erreichen wir die Schleuse vom alten Assuan Staudamm.
Während
das Schiff wartend vor den Toren hält, nähern sich kleine Ruderboote, die
verschiedenste Sachen anbieten. Alles
nahezu „geschenkt“.
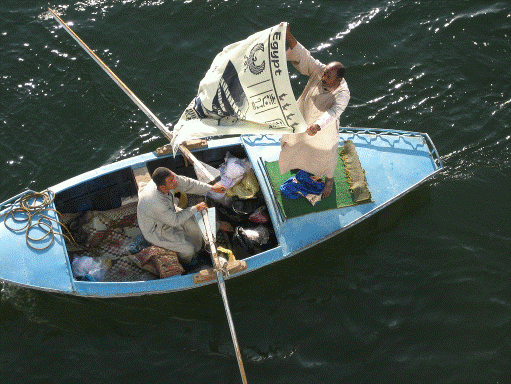
Die Art
ihres Angebotes erscheint besonders
originell. Eingewickelt in Plastiksäcke werfen sie ihre Schätze (Tischtücher,
Handtücher, Tunicas, Galabeas…)
an Bord, in der Erwartung dass eine KäuferIn das
entsprechende Geld hinunterwirft. Wenn die Sachen nicht gefallen, werden sie in
die Boote zurückgeworfen, wobei sie nicht selten im Wasser landen. Nach den komplizierten
Verkaufsverhandlungen rudern die Männer in die Mitte des Flusses, wo sie an die
stromabwärts fahrenden Frachtschiffe mit Seilen andocken und sich ziehen
lassen.



Während
dieser geschickten Manöver, bewegt sich unser Schiff in Richtung Schleuse. Dort
wird es mit Seilen festgezurrt, während sich langsam die Schleusentore
schließen. Es geht sehr schnell das Auffüllen der Schleusenwanne und bald sind
wir wieder unterwegs auf dem Fluss Richtung Edfu.
Noch ein Wort zur Abendunterhaltung am Schiff. In
Luxor gab es zweimal Programm am Abend, und zwar in den Barräumen. Am ersten
Abend gab es eine Bauchtänzerin, über deren Kunst besser der Mantel des
Schweigens gebreitet bleibt. Danach tanzte eine Art junger Derwisch mit bunten
Gewändern einen sehr sehr eindrucksvollen Rundtanz,
der mit einheimischen Rhythmusinstrumenten begleitet wurde. Fast eine halbe
Stunde drehte er sich zu den Rhythmen im Kreis, indem er immer wieder neue
Figuren aus seinen bunten Gewändern und der Bewegung zauberte. Zuletzt – so mein Eindruck- war er
schon selbst schon in die Bewegung eingeschmolzen. Das Wort Trance würde es
nicht wirklich treffen, weil er am Ende der Vorstellung sofort da war.

Der Horustempel von Edfu ist ein
Plagiat, dem man das auch ansieht. Von den Ptolemäern im 2. Jh. vor Christus
errichtet ist er einer der vollständig erhaltensten,
aber auch eine sehr unkünstlerische Zitation der alten
Muster. Schon die Reliefs des Eingangspylon machen deutlich, dass hier nur
Schablonen aufgelegt und nachgemeißelt
wurden

Die
Proportionen stimmen einfach nicht. Besser gelingt die Gestaltung der Statuen –
dafür gab es offensichtlich noch eine Steinmetzhütte, die altes Wissen
verwaltete.
Bevor wir
den Tempel betreten, berichtet unser Reiseführer von den geschichtlichen
Hintergründen des Baues und führt uns dann zu einem bekannten Relief: der
Darstellung der Grundsteinlegung des Tempels und später der Öffnung des Tores
im Beisein des Horus. Ungewöhnliche und neue Darstellungen, die erfrischend vom
überlieferten Kanon abweichen.

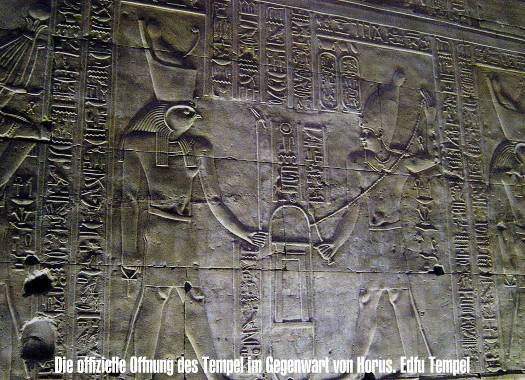
Als
Überraschung erwartet uns auch ein fast vollständig erhaltener Altarraum. Die
Götternische entbehrt zwar des Götterbildes, aber die Götterbarke, worauf das
Bild zu den Menschen hinausgetragen wurde, steht in Kopie vor uns. Das Original
befindet sich allerdings im Louvre.
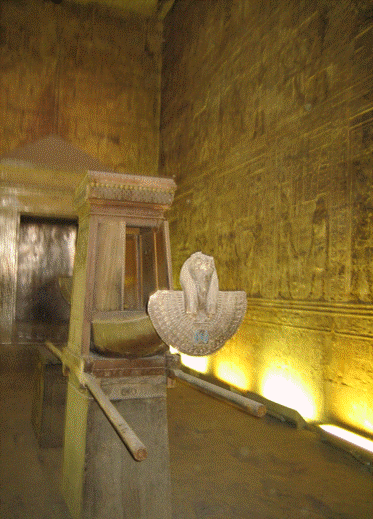
Dieser
kleine sakrale Raum verströmt einen ganz merkwürdigen Zauber, den auch die
Jahrhunderte nicht ganz auslöschen konnten und auch nicht die Blicke der vielen
Touristen. Der Tempelumgang führt durch Räume für die Opfergaben und ist wieder
in der bekannten Weise geschmückt. Die Reliefs sind etwas grob geraten, aber
dennoch recht eindrucksvoll. An der westlichen Innenmauer findet
sich immer
wieder Horus, wie er dem Gott Seth in verschiedenen Tiergestalten nachstellt
und tötet. Doch dieser hat das ewige Leben. Immer wieder erhebt er sich, sowie
das Böse in der Welt einfach nicht ausstirbt.
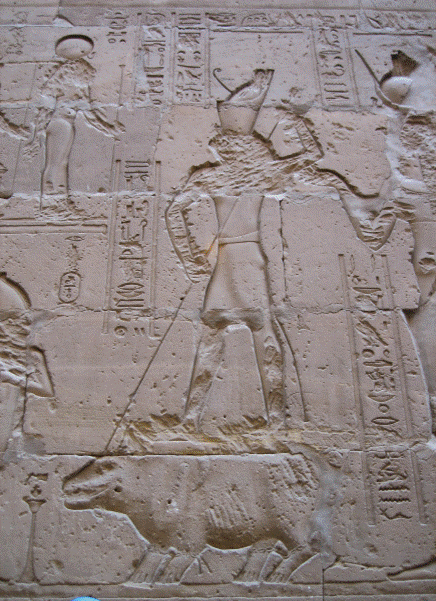
Horus-Tempel
Die Griechen, die Horus mit ihrem Gott Apollon
gleichsetzten, nannten Edfu, Apollonopolis.
Der Horus-Tempel von Edfu wurde
unter den Ptolemäern (237-257v. Chr.)errichtet. Wie üblich zeigt der
Eingangspylon den Pharao, wie er den Feind am Schopf gepackt hält und mit einer
Keule auf ihn einschlägt. Das Tor im Turmberg,
das von zwei großen Falken flankiert
wird, führt in einen Innenhof mit 32 Säulen. Die Wände der Kolonnaden zeigen
sich wiederholende Szenen, in denen der Pharao den Göttern opfert. Die Front
der Vorhalle an der Rückseite des Hofes besitzt die oben typische Hohlkehle; an
den halbhohen Säulenschranken ist Energetes II.
abgebildet, indem er Horus und Hathor Opfer
darbringt.
Die Decke der Vorhalle wird von 12 Säulen mit
Blumenkapitellen getragen. Auch hier sind die Wände über und über mit
vertieften Reliefbildern geschmückt; sie zeigen das ganze Repertoire der
sakralen Handlungen. Interessant ist an der Westwand unten, die Darstellung des
Pharao bei der Grundsteinlegung des Tempels. Die westliche Kapelle neben dem
Eingang dient als Weiheraum, worin Horus
und Thot abgebildet sind, wobei sie den Pharao mit Wasser übergießen. Die östliche
Kapelle diente einst als Bibliothek.
Der Architrav über dem Tor zur Säulenhalle zeigt das
Sonnenschiff mit Götter-darstellungen. Schmale Luken
lassen Licht ins Dunkel des Säulensaales ein, in dem 12 Säulen mit
Blumenkapitellen die Decke stützen. An den Wänden werden die gleichen Themen,
wie in der Vorhalle behandelt. Der westliche Nebenraum diente einst als Labor.
Seine Inschriften nennen Rezepte für Salben und Weiheöle,
womit die Priester die sakralen Handlungen vollzogen.
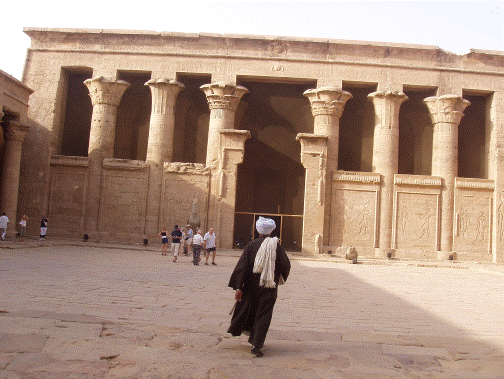
|
|
|

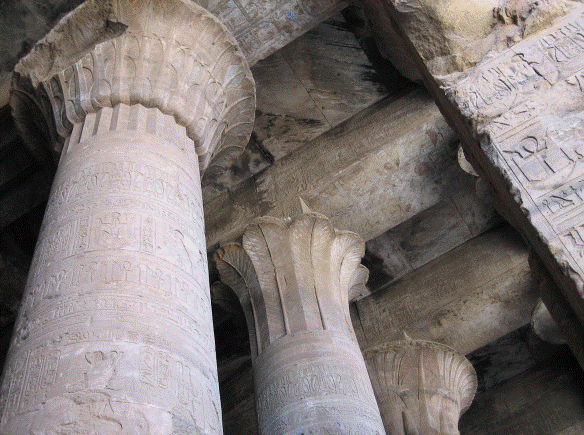
Vom angrenzenden ersten Vorsaal aus führen Treppen auf das
Tempeldach. Hier zogen die Priesterprozessionen mit dem Kultbild zu Beginn des
neuen Jahres ins Freie, damit die Strahlen der Sonne dem Gott neue Kraft
zuführen konnten. Über den zweiten Vorsaal gelangt man in das Allerheiligste.
Der Granitschrein hier gehörte zu einem älteren Tempel; auf dem Sockel stand
einst die Götterbarke. Rund um das Sanktuarium verläuft ein Korridor, wovon
eine Reihe kleinerer Kammern zu betreten
sind. In ihnen bewahrten die Priester die kultischen Geräte auf und alles
andere, was für das Ritual benötigt wurde. In den beiden Eckräumen führen
Stufen hinunter zu den Krypten des Heiligtums.
Der innere Tempelumgang erreichbar über Durchgänge in der
Ostwand des Säulensaales
bzw. in der Vorhalle, zeigt löwenköpfige Wasserspeier,
darunter eine Prozession des Herrschers nebst Gemahlin zu den Göttern und
interessanten Darstellungen an der westlichen Umfassungsmauer; Horus kämpft
hier gegen seine Feinde, symbolisiert durch Krokodile und Flusspferde.
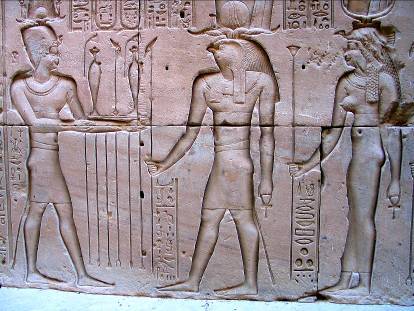
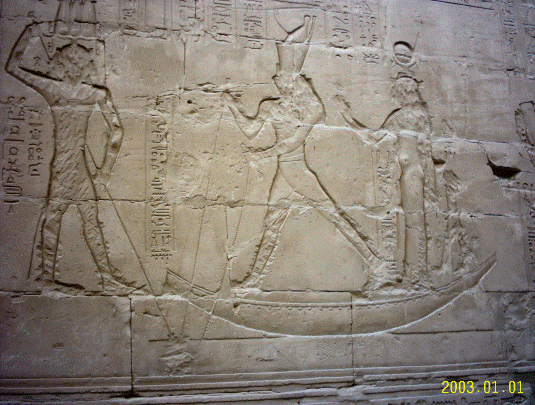
Stromaufwärts
geht es nach dem Mittagessen weiter nach Kom Ombo, dem Doppeltempel, der dem
Krokodilgott Sobek
und Horus( Horus, als Sohn des Re) geweiht ist. Auf einem Felsplateau, das zum Nil hin
abfällt wurde dieser merkwürdige Tempel errichtet, der in seinem Stilgemisch fasziniert und beeindruckt.

Besonders
ausdrucksvoll erweisen sich die geflügelten Sonnendarstellungen, die durch ihre
Doppelung über den Tempeleingängen eine starke Präsenz entwickelt. Sehr schön
sind auch die Kompositkapitelle der Säulen, wo schon die Erfahrung der ausländischen
Steinmetze mit eingearbeitet sind.

Wie zu
erwarten, beschäftigen sich die Reliefs
an den Säulen immer wieder mit den Göttern, die hier verehrt werden. Die
Darstellungen des Krokodilgott Sobek scheinen mir
von einem besonders begabten Steinmetz herausgemeißelt…

Der Doppeltempel von Kom Ombo
Da das
Heiligtum zwei Göttern geweiht ist, dem Krokodilgott Sobek und dem Haroeis (Horus als Sohn des Re),finden wir hier eine Doppelanlage vor, die
entlang der Längsachse in zwei symmetrische Hälften geteilt ist. Beide Areale
folgen den klassischen Grundsätzen der ägyptischen Tempelarchitektur; beide
Hälften besitzen einen eigenen Eingang. Auch dieser Tempel datiert aus der Ptolemäerzeit, doch haben auch einige römische Kaiser, vor
allem Tiberius ihre Spuren hinterlassen.
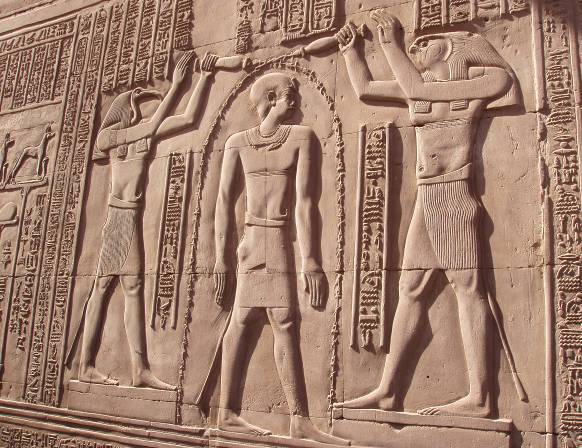
Der erste
Pylon ist fast völlig verschwunden, und von den Kolonnaden der Vorhalle gibt es
nur wenige Säulenstümpfe. In der Mitte des Hofes finden sich Reste eines
Altares und zwei Granitwannen, die wahrscheinlich zu rituellen Waschungen
dienten. Zehn Säulen schmücken die Vorhalle, deren Reliefs Kultszenen zeigen.
Von dort führen zwei Tore in den Säulensaal, der mit 10 Papyrosbündelsäulen
geschmückt ist. Zwischen den Türen zeigt ein Relief das heilige Krokodil von Ombos.
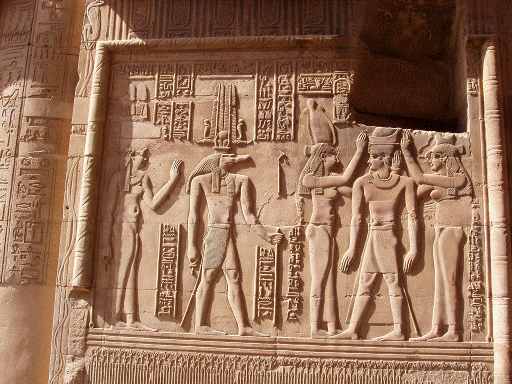
An der nördlichen Wandseite überreicht Haröis
dem Pharao Euergetes II. das Sichelschwert. Hinter
dem Pharao schreiten seine Schwester und seine Frau, die beide den Namen
Kleopatra tragen.
Zwei
weitere Tore geleiten in die drei hintereinander liegenden Vorhallen.
Interessant ist das Relief an der Rückwand des dritten Saales. Es zeigt den
Herrscher Philometor mit seiner Gattin Kleopatra vor
dem Mondgott Chons, der den Namen des Herrschers in
einen Palmzweig ritzt – Symbol für die Verheißung einer langen Regierungszeit.
Nur noch Reste weisen auf die Sanktuarien hin, die einst von den üblichen
Nebenkammern umgeben waren.
Am
weitgehend zerstörten Mammisi ist ein Relief
erhalten, das Euergetes zusammen mit zwei Göttern
zeigt, wie sie auf der Barke durch die Papyrossümpfe gleiten. Der Köng
zupft estwas gelangweilt an den Halmen. Statt eines
Mungos lassen die Steinmetze einen Löwen auf einem Stengel
hochschleichen – Zeugnis einer sinnentleerten Symbolik, die sich überlebt hat
nach mehr als 3000 Jahren…
Heute geht
es schon sehr früh am Morgen Richtung Abu Simbel.
Noch in der Dunkelheit geht es los und ich versuche noch ein wenig zu schlafen.
Doch es gelingt nicht wirklich, weil ich ganz aufgeregt auf den Sonnenaufgang
warte. Tatsächlich gelingt es mir den Sonnenaufgang über den Weiten der Wüste
mitzuerleben und einzutauchen in diese völlig fremde Natur, die uns durch ihre
Schönheit anzieht, durch ihre
Lebensfeindlichkeit aber gleichzeitig zurückweist.
Abu Simbel
Es war der Schweizer Orientforscher Jakob Ludwig Burckhardt,
der im März 1813 die beiden Heiligtümer
entdeckte. Sandverwehungen hatten in den vergangenen Jahrtausenden die Tempel
fast vollständig zugedeckt, nur die Köpfe der Riesenstatuen ragten aus dem Wüsten-sand heraus. Seine Ausrüstung erlaubte ihm nicht in das
Innere der Tempel vorzudringen. Das besorgte der raubende Abenteurer Belzoni
vier Jahre später; er und sein Team legten die Tempel frei.
Eine Treppe führt hoch zu der Terrasse, auf der die vier
sitzenden 20m hohen Kolossalstatuen von Ramses II.,
wahrhaft majästetisch in den Himmel ragen. Die linke
der Figuren ist am besten erhalten. Die zweite war schon kurz nach ihrer
Fertigstellung geborsten – der Oberkörper lag am Boden, die dritte ließ Sethos II. restaurieren. Ramses
ist im vollen Ornat dargestellt, mit der Doppelkrone von Ober- und
Unterägypten, der Uräusschlange an der Stirn und dem Götterbart am Kinn.
Zwischen den Füßen des Herrschers und auch zwischen den Kolossalstatuen finden
sich kleinere Darstellungen von Familienmitgliedern Über den Statuen verläuft
ein Fries, geschmückt mit Pavianen, die ihre Arme der aufgehenden Sonne
entgegenstrecken, darunter zeigt die Hohlkehle den Namen des Herrschers in
einer Katusche. Über dem Eingang thront der
Sonnengott als falkenköpfiger Re-Harachte; zu seiner
Rechten und Linken Ramses, der ihm in klassischer
Pose die Göttin Maat darbringt.
An der südlichen Begrenzung der Terrasse erinnert die Hochzeitsstele an die politisch motivierte Ehe von Ramses mit der Tochter des Hethiter-Königs. Durch das Tor
gelangt man ins Innere des 55m langen Tempels In der ersten Halle zeigen acht
10m hohe Osiris Pfeiler erneut der Pharao. Rechts an der Eingangswand züchtigt
der König eine Anzahl Feinde von Re-Harachte, auf der
anderen Seite geschieht es vor Amun-Re. An der
südlichen Seitenwand zeigen die Reliefs oben Darstellungen des Herrschers vor
verschiedenen Göttern; darunter links Ramses, wie er
in seinem Streitwagen auf eine asiatische Festung zugaloppiert
und die vor Angst gelähmten Feinde auf den Zinnen mit Pfeil und Bogen tötet, in
der Mitte spießt er einen Libyer mit der Lanze auf, rechts die Darstellung des
Triumphzuges, mit dem der siegreiche Ramses die
Feinde in die Gefangenschaft führt.
Die nördliche Seitenwand verherrlicht die Schlacht gegen die
Hethiter bei Kaddesh.
Oben links der König in seinem Streitwagen von Feinden
umzingelt, in der Mitte in einer Schleife des Orontes
liegende Festung Kaddesh mit ihren Verteidigern auf den Zinnen der Brustwehr, rechts die
Heerführer des Königs, die ihm Gefangene vorführen und die Gliedmaßen der toten
Feinde zählen. Unten links der Marsch der ägyptischen Truppen, dann das
Heerlager mit dem König beim Kriegsrat, schließlich die bekannte Szene, wie
zwei feindliche Spione verdroschen werden, rechts der Kampf der ägyptischen
Streitwagen gegen die gleichermaßen anstürmenden Hethiter. An der Rückwand ist
der siegreiche Ramses zu sehen, der Gefangene vor
verschiedene Götter führt, auf der anderen Seite geleitet er gefangenen farbige, erkennbar an
den wulstigen Lippen, vor die Gottheiten.
Einige der Seitenkammern beinhalten noch Tische, worauf
früher Vorräte und Opfergaben gestapelt waren. Die Wandreliefs vermitteln
religiöse Szenen. IN der Vierpfeilerhalle
wieder die Darstellung einer Barkenprozession. Im Sanktuarium
schließlich findet sich der Sockel für die heilige Barke; in der Nische
dahinter thront Ramses inmitten der Göttertrinität: Amun, Ptah und Re.
Am 21. Oktober und 21. Februar treffen die Sonnenstrahlen
der aufgehenden Sonne das Allerheiligste im tiefsten Punkt des Tempels und
berührt die Figuren der Götter und des Herrschers
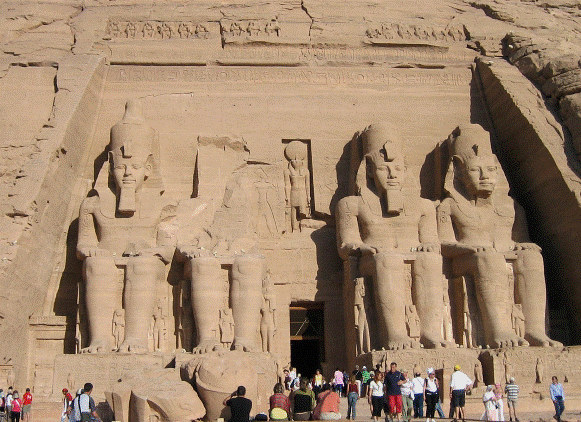
Der obige
Text fasst die Konzeption des Tempels gut zusammen. Doch kann ein Text die
ungeheure Wucht, womit die Ramsesgestalten am
Eingangspylon auf den Betrachter einwirken, nicht einfangen. Das kann man nicht
mit Worten schildern, man muss es erleben. Und wieder frage ich mich, welche
geistige, psychische Verfassung den Menschen Ramses
II. dazu gebracht hat, sich wenn irgendwie möglich, in Überlebensgröße und
als Gott – insbesondere in Abu Simbel- wo er sich im Tempelraum in der Gestalt des Gottes
Osiris achtmal in Stein meißeln lässt. Ich glaube, dass die
Machtfülle und Verehrung durch Priester und Volk, die er zweifellos in hohem
Grade genoss, nicht ausreichen um dieses Phänomen der Selbstverherrlichung zu
erklären. Doch letztlich sind alle Spekulationen darüber müßig, weil für
moderne Machthabern die Umsetzung von
ähnlichen Wünschen in Stein und Granit nicht mehr angebracht ist.
Die
Riesengestalten des Pharao Ramses II. vorm
Eingangspylon wirken irgendwie vertraut. Zu oft hat man Bilder von Abu Simbel gesehen. Beim Näherkommen lösen sich die Gestalten allerdings in Einzelemente auf, weil der Blick die Monumentalität der
Gestalten nicht festhalten kann. Was bleibt, ist ein Gefühl des Überwältigtseins, ein Eindruck, der offensichtlich auch vom
Erbauer beabsichtigt wurde.

|
|
Linker Hand vor dem dunklen Holztor wurde
wieder das Sujet von der Vereinigung von Ober – und Unterägypten bedient, uns
zwar mit hoher Meisterschaft des Meißels. |
Ein
gewisse Einförmigkeit und Mangel an Originalität im Hinblick auf die
dargestellten Szenen, lässt sich zweifellos nicht leugnen. Doch darf nicht
vergessen werden, dass in Ägypten Kontinuität in allen Lebensbereichen
verankert war. Warum? Weil es existenziell notwendig war, dass der Nil Jahr für
Jahr zur selben Zeit aus seinen Ufern trat, um das Land zu ernähren. Sie waren
nicht gewohnt auf zufällige Regengüsse
zu warten und zu hoffen, dass Regen ausreichend und rechtzeitig vom
Himmel fällt. In unseren Breiten können wir kaum erwarten, dass Regen zu
bestimmten Zeiten kommt. Wir müssen hoffen,
ohne Garantien bezüglich Ort und Zeit.
Für
Ägypten wurde und wird die existentielle Frage sehr ungewöhnlich gelöst, und
heute wie damals beruht der Ernteertrag auf der regelmäßigen Zufuhr von
gewaltigen Wassermengen durch den Nil für ihr Land.
Kontinuität
prägt sogar die Vorstellung der alten Ägypter vom Leben im Jenseits. Wenn man schließlich durch alle
Tore hindurch bei Osiris ankommt und die Prüfung besteht, dann erwartet einem
nichts anderes, als dasselbe Leben, wie hier auf Erden. Mit Essen und Trinken,
Arbeiten, ect. Es scheint so, dass das Verharren im
Hergebrachten gleichsam als Garantie verstanden wurde, dass sich ja nichts ändert. Weil Änderung nur in Richtung
Verschlechterung gedeutet wurde.
Doch
zurück zu den Osiris-Ramses Gestalten im Tempel
selbst. Zunächst ist man wieder schwer beeindruckt von dem großen, bunt
bemalten Raum, der im Vergleich zu den abgewitterten
Hallen der bereits besuchten Tempeln, wesentlich lebendiger wirkt.



Auch hier
jagen die ramisidischen Streitwagen nur so über
die Wände. Es werden Feinde besiegt
verfolgt und ihre abgeschlagenen Köpfe vorgezeigt. Alles im Grund ein
Kriegshymnus, der die „kosmische Ordnung“ wieder herstellt. Er hat
vortreffliche Arbeiter hier eingesetzt der Bauherr Ramses.
Schließlich war es auch SEIN Tempel, weitab von Theben,
wo die alteingesessene Kaste der Priester vermutlich grossen
Einfluss hatte. Hier in dieser Wüstenlandschaft war er selbst Herr und Gott;
und die Priester, die hier dienten, waren zweifellos von seinen Gnaden
eingesetzt. Die Gestaltung der Kriegsszenen besticht durch ihren hohen
künstlerischen Rang. Dasselbe gilt auch für die Opferszenen im Vorraum der
Cella. Die vier Göttergestalten wirken demgegenüber relativ plump und statisch.
Auch scheinen sie zuviel gewaschen und gesalbt
worden, weil ihre Gesichtszüge nicht mehr wahrnehmbar und auch sonst die
Oberfläche der Figuren ziemlich mitgenommen wirkt.
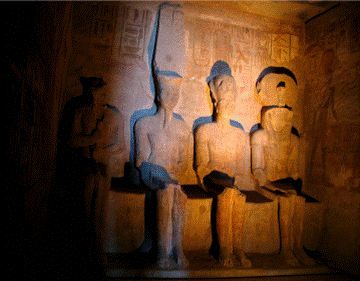
Später
sitze ich zu Füßen von der Osiristatuen und studiere
ihre Gestalt und Farbgebung.
Obwohl sie
auch schon etwas abgeblättert sind, strahlen die Figuren doch eine Präsenz und
Faszination aus, die ich mir nicht erklären kann. Vielleicht beseelt sie doch
in geheimnisvoller Weise ein göttlicher Geist?
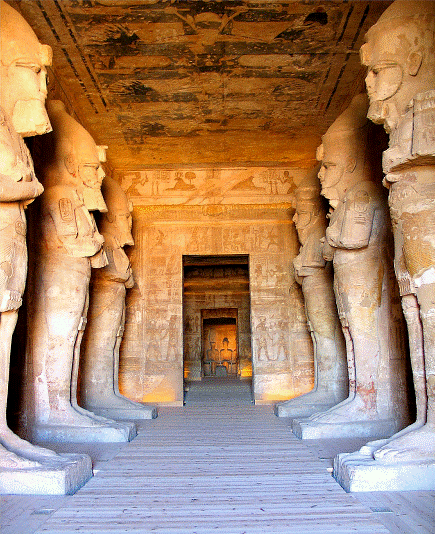
Ich nehme
langsam Abschied und schlüpfe durch das
Tempeltor hinaus auf das felsige Plateau, wo sich inzwischen viele
Gruppen von Touristen eingefunden haben, damit man ja nicht vergisst, dass hier
eines der wichtigsten Denkmäler des touristischen Interesses vor uns haben. Oder besser schon hinter uns
haben…
Noch voll
von den Eindrücken des Tempels der Amun, Ptah und Re geweiht war, oder eher Ramses
II, wandern wir hinüber zu dem Hathor- Tempel.
Hathor
war
ursprünglich allein die Göttin der Liebe, der Fröhlichkeit, des Tanzes.
Später
wurde sie mit anderen Gottheiten verschmolzen: Herrin der fernen Länder, Herrin des Türkislandes(Sinai) in Theben und
Memphis: Schutzgöttin des Wüstengebirges
der Toten
Die Amme der Könige, die Leuchtende, die Glänzende.
Ihr
Hauptheiligtum ist ihr Tempel in Dendera. Alle
späteren von den Griechen mit Aphrodite benannten Plätze waren ehemals Hathorkultstätten. Die sieben Hathoren
entsprechen unseren Feen oder den Schicksalsgöttinen
und können die Zukunft voraussagen.
Darstellung:
Menschengestalt, manchmal mit lyraförmigen Kuhhörnern und Kuhohren.;
in der Hand ein blühender Papyrusstengel. Auch als
Kuh dargestellt oder kuhköpfig.
Den
kleinen Hathor-Tempel
ließ Ramses II. zu Ehren seiner
Gattin Nefertari und der Göttin Hathor
in den Felsen hauen. Schrägstehende Strebepfeiler gliedern die 12m hohe, pylonähnliche Fassade,
worin sechs Kolossalstandbilder in
Nischen so angeordnet sind, dass auf jeder Seite einmal die Königin zwischen
zwei Standbildern des Königs steht: als gleichgroße Figuren und zwar der Sonne
zugewendet. Ihnen zu Füßen kleinere Nebenfiguren, die Kinder des königlichen
Ehepaares. Ein Kobrafries beschützt den
Tempeleingang.
Der Tempelgrundriß ist streng
symmetrisch und gliedert sich in einen Sechspfeilersaal, Querhalle mit
Nebenkammern und Allerheiligstem. Im Säulensaal sind zur Tempelachse hin die
Säulen mit Sistren und Hathorköpfen mit fallenden
Locken geschmückt, an den anderen Seiten mit Texten und Reliefbildern zum Thema
Königsfamilie und Götter.
Drei Türen führen in die Querhalle vor dem Allerheiligsten,
das in einer Nische endet. Dort befindet sich das Relief der Hathorkuh, die den Kopf des Königs darunter beschützt. Alle
Wandreliefs zeigen das Königspaar beim Opfern und im Umgang mit den Göttern Vor
allem mit Hathor und Isis, aber auch mit Anuket, der Kataraktgöttin.
Auffallend ist die überschlanke feingliedrig gestaltete
Figur der Königin, was auf hohe Porträtähnlichkeit hinweist. Selbst die
Farbgebung ist hier anders als üblich – vorherrschend ein helles Goldgelb,
vielleicht im Bezug auf Hathor mit dem Beinamen, Die
Goldene.
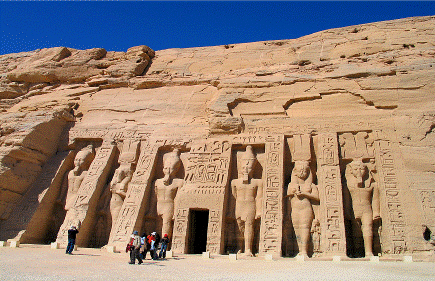
Die obere
Beschreibung des Tempels entspricht sehr genau den Einzelheiten, die man
schauend und erforschend vor Augen hat. Zunächst die Fassade, wieder aus
Distanz betrachtet, eindrucksvoll und überwältigend. Im Tempel selbst, der
kleiner und überschaubarer ist, fesseln die Säulen mit Hathorköpfen
sofort den Blick. Langsam gewöhne ich mich an die ungewöhnliche Gestaltung
dieser Art Säulen, die am Anfang sehr
seltsam berühren, weil Säulen im antiken Raum nur schön gestaltete
architektonische Elemente sind, während hier auch die Säulen in die religiöse
Meditation einbezogen werden.
|
|
|
Die Wände dieses Tempels entbehren
der kriegerischen Szenen. Hier wird nur den verschiedenen Göttern geopfert.
Viel Zeit ist nicht um in die schönen Szenen zu versinken, doch es ist angenehm
hier zu sein und die vertrauten Bilder, die sich in Farben und nahezu
unversehrt erhalten haben, betrachten zu können. Wunderschönen Frauengestalten,
ihre Silhouetten, die jedem modernen Modell Ehre machen können grüßen von den
Wänden und wieder ist es Hathor in der Gestalt einer
Kuh, die mit besonderem künstlerischem Geschick herausgearbeitet wurde.
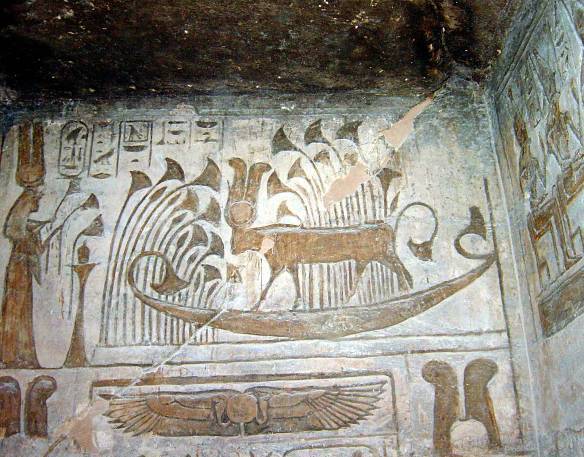
Doch auch
alle übrigen Szenen verraten eine hohe Meisterschaft der Gestaltung, woraus
sich unschwer ableiten lässt, dass Ramses II für seinen persönlichsten Tempel die
größten Meister des Meißels und der Farbe ausgesucht hat.
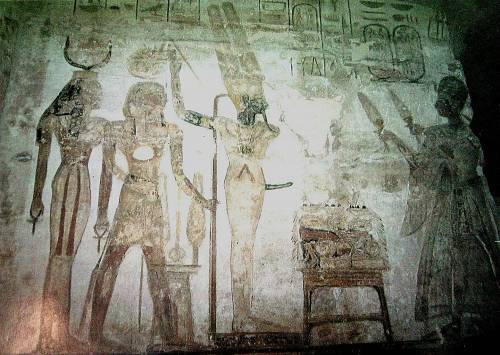

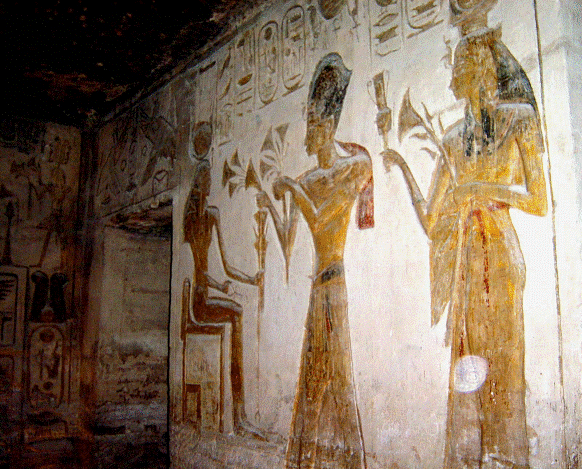
Ich verlasse den Tempel mit dem Bewusstsein, dass ich hier
die Meisterwerke der ägyptischen Baukunst sehen durfte. Dann wende ich noch
einmal den Blick zurück zu den Hügeln, die sich sanft nach hinten wölben und
dann über die Terrasse hinunter zum Stausee, der sich blau und ruhig weit
hinein in den Horizont erstreckt. Obwohl er das Ergebnis eines modernen
Staudammes ist, passt er in die traditionelle Atmosphäre dieses Landes. Nunmehr
kann fast das ganze Jahr bewässert werden und die Angst, dass der heilige Nil,
einmal seine Wasser zurückhält, ist dadurch gebannt. Dass naturgemäß neue
Probleme entstehen, wie dass hinter der Staumauer der fruchtbare Schlamm
angesammelt wird, der im Unterlauf
fehlt, ist eine Tatsache, wozu sich die Ingeneure
noch Lösungen einfallen lassen müssen.
Andererseits
träumt man von einem Effekt, der zusätzlichen Regen bringen könnte, auf Grund
der Feuchtigkeit, die von dieser weiten Wasseroberfläche aufsteigt.
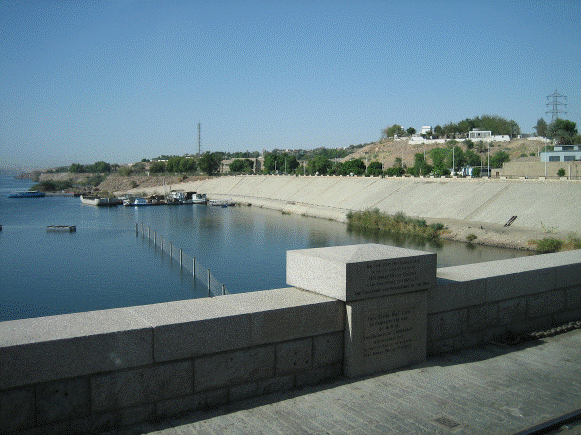
Der
Staudamm selbst ist ein Wunderwerk der Technik, zweifellos.
Wir
wandern am folgenden Tag auf der Krone des Dammes herum. Beeindruckend sicher,
aber letztendlich doch ein äußerst massiver Eingriff in die Natur, dessen
Folgen noch nicht wirklich abzusehen sind.
Die Stadt
Assuan selbst ist eine Ansammlung von Häuser, nicht mehr. Hier besuchen wir
eine Moschee, die koptische Kirche und einen Basar. Die Moschee liegt sehr
schön auf einem Hügel mit Blick nach Osten. Nach dem Schuhritual betreten wir
den Raum, der im bekannten Muster gestaltet ist.
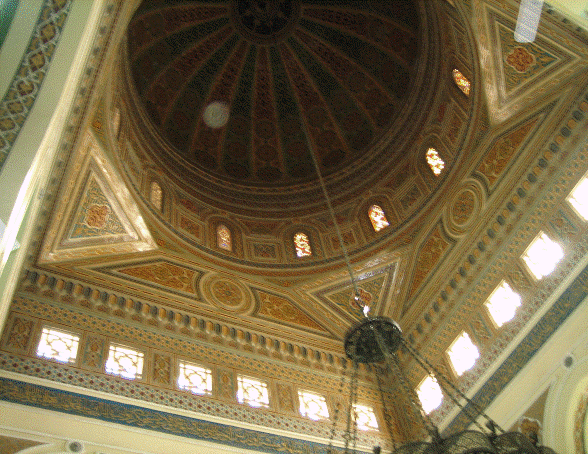
Unser
Führer versucht uns in einer halben Stunden die Grundzüge des Islams zu
vermitteln, was naturgemäß nicht ganz leicht ist. Was mich an den Erklärungen
fasziniert, ist der starke Glaube, der in seiner Erklärung mitschwingt. Er weiss, wovon er redet und mich fasziniert es, einen
wirklich gläubigen Menschen vor mir zu haben. Später werden wir uns noch einmal
intensiv über das Christentum unterhalten, dessen wesentliche Linien er zwar
kennt, aber von mir im Detail erklärt haben will.
Das Innere
der koptischen Kirche erinnert an die Gestalt der christlich orthodoxe
Sakralräume. Auch hier trennt eine Ikonostase, eine Bilderwand, den
Altarraum
von dem Raum der Gemeindemitglieder. Die Ausschmückung des Raumes ist aber sehr
dürftig. Es gibt keine Wandmalereien, keine Bilder. Man spürt, dass es eine
sehr arme christliche Gemeinde ist, die hier ihren Gottesdienst feiert.
Draußen
gibt es Andenkenläden, die christliche
Schmuckgegenstände anbieten. So wie überall feiert der Kitsch hier „fröhliche Urstände“.
Später,
während wir noch auf unserem Bus warten schreiten zwei „nubische Prinzessinnen“
vorbei, d. h. zwei junge Frauen, die in Haltung und Gebärde eine Würde an den
Tag legen, wie ich noch selten gesehen habe. Zudem waren sie von auffallender
Schönheit. Unwillkürlich fühle ich mich
durch sie an die Gestalten im kleinen Hathor Tempel
erinnert und freue mich, dass es hier offensichtlich wirklich lebendige Modelle
für die Göttinnen gibt.

Unsere
Fahrt durch die ägyptische Vergangenheit ist damit zu Ende. Aber noch bleiben
uns einige Stunden am Schiff, das uns stromabwärts nach Luxor bringen wird.
Noch dürfen wir das Dahingleiten des Bootes auf dem stillen Strom nachdenkend
genießen und die wechselnde Uferlandschaft bewundern.
Rilke dazu:
„Fänden auch wir ein reines, verhaltenes schmales/
Menschliches, einen unseren Streifen Fruchtlands/ zwischen Strom und Gestein.“
(aus Duineser
Elegien, zweite Elegie Jänner /Februar 1912)

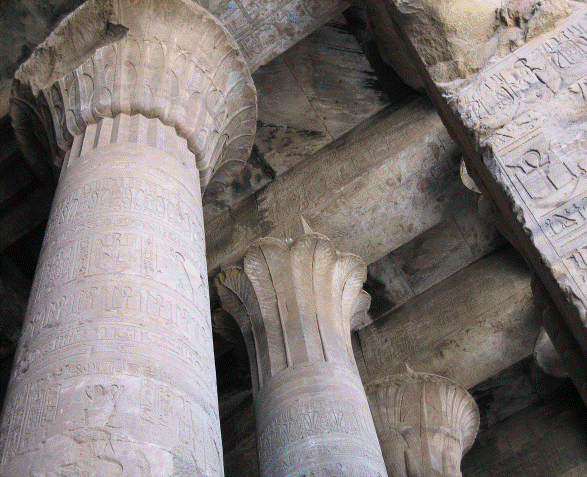 Balkendecke
vom Horustempel von Edfu
Balkendecke
vom Horustempel von Edfu